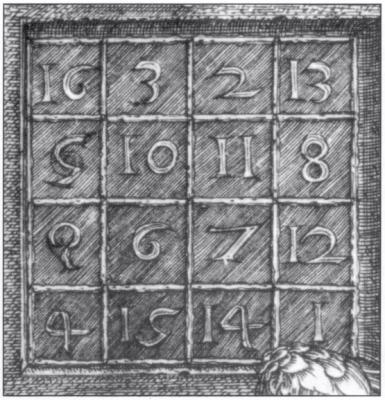... newer stories
Donnerstag, 19. Mai 2011
Vagabundierende Planeten
klauslange,22:09h
Wie Forscher herausgefunden haben, sind vagabundierende Planeten, also solche, die kein Mitlgied eines Sonnensystems sind, sehr verbreitet und keine Ausnahme. Übrigens: An diesem Beispiel sieht man wieder, wie unbrauchbar die Planetendefinition der Internationalen Astronomischen Union ist. Nach dieser Definition muss ein Planet, um als solcher bezeichnet zu werden, ein Zentralgestirn umkreisen. Doch wie der Bericht zu sagen weiß, dürfte es mehr dieser Vagabunden in der Milchstrasse geben, als Sterne in unserer Galaxis.
astronews berichtet: hier.
astronews berichtet: hier.
... link (0 Kommentare) ... comment
Sonntag, 15. Mai 2011
CLOUD: Klima und kosmische Strahlung
klauslange,21:41h
Wie kosmische Strahlung unser Erdklima beeinflusst und dies bislang sträflich vernachlässigt wurde. Ein interessantes Interview:
... link (0 Kommentare) ... comment
Samstag, 14. Mai 2011
Politik blockierte wirksamen atomaren Katastrophenschutz
klauslange,19:12h
Wie Focus zu berichten weiß, hat die Politik in den letzten Jahrzehnten einen wirksamen Schutz gegen den atomaren Ernstfall blockiert.
Zum Bericht gehts hier.
Zitat:
Sie wollten das Schlimmste verhindern – irgendwie. Im Atomkraftwerk Neckarwestheim war ein Brand ausgebrochen. Die Flammen wüteten im Pumpengebäude eines Kühlturms, ein Mitarbeiter wurde vermisst.
In Spezialanzügen und unter schwerem Atemschutz preschten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Gemmrigheim in die Brandzone vor. „Trotz schwierigster Bedingungen“, so steht es im Einsatzbericht, konnte die Gefahr „sehr zeitnah“ gebannt werden. Die Operation sei „einwandfrei“ verlaufen.
Kritik an mangelnden Konzepten
So oder so ähnlich fallen die meisten Bilanzen nach Notfallübungen in Atomkraftwerken aus. Alles habe „reibungslos funktioniert“, heißt es dann. Auf den Ernstfall sei man „gut vorbereitet“.
Das klingt wunderbar beruhigend. Man könnte glauben, selbst die Explosion eines Reaktors stelle für deutsche Krisenmanager kein Problem dar.
Ein fataler Irrtum, warnen Experten. Katastrophenforscher und Rettungskräfte halten das Konzept zum Schutz der Bevölkerung bei atomaren Bedrohungen für eine Farce. Es fehle an Warnsystemen ebenso wie an brauchbaren Plänen für Massenevakuierungen und zur Behandlung von Strahlenopfern.
Den unmöglichen Ernstfall proben
Der von Behörden erweckte Eindruck, jede Havarie sei beherrschbar, mutet angesichts der Erfahrungen früherer Übungen zynisch an. Immer wieder kam es zu Pannen, die im Realfall wohl viele Menschen das Leben gekostet hätten. Dabei wurden nur Szenarien geprobt, die nicht annähernd den Unglücken von Tschernobyl oder Fukushima entsprachen.
„Solche Dimensionen haben bei unseren Vorbereitungen nie eine Rolle gespielt“, kritisiert Hartmut Ziebs, Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbands. Er glaubt, dass dies „politisch so gewollt“ war. „Warum sollte man sich auf einen Fall vorbereiten, von dem es immer hieß, er werde niemals eintreten?“
...
Vorbeugung gegen personellen Notstand
Selbst für Rettungskräfte lässt sich keine Prognose abgeben. Jutta Helmerichs, Leiterin des psychosozialen Krisenmanagements im BBK, rechnet damit, dass etliche Helfer der psychischen Belastung nicht gewachsen sind – und aus Angst um das eigene Leben oder Sorge um die Familie den Dienst verweigern. „Auf wie viele Helfer dann verzichtet werden muss, kann nicht vorhergesagt werden“, so Helmerichs.
Ein personeller Notstand bei den Rettern wäre das Letzte, was ein Land im Ausnahmezustand gebrauchen kann. Deshalb bieten Bund und Länder spezielle Fortbildungen für Einsatzkräfte an, die bei atomaren Unglücken ausrücken müssen. Auch die Verantwortlichen in den Krisenstäben sollen künftig besser geschult werden.
Pläne liegen in Schubladen
Im Moment jedoch, warnt der Katastrophenforscher Wolf Dombrowsky, sei Deutschland auf atomare Schadensfälle „nicht ausreichend vorbereitet“. Das Schutzkonzept für die Bevölkerung sei teilweise „lückenhaft und grobschlächtig“, es gebe „kaum geeignete Antworten“ auf Fragen, die sich nach einer Tragödie wie in Japan stellen. „Ich habe erhebliche Zweifel, ob das bestehende Krisenmanagement im Ernstfall auch nur ansatzweise funktionieren würde.“
Zwar lägen viele Pläne in den Schubladen. Doch mit „Tabu-Denken und politischer Rücksichtnahme“ hätten die Verantwortlichen einen „wirksamen Bevölkerungsschutz vor atomaren Gefahren bislang blockiert“, so Dombrowsky.
Deutschland brauche dringend „ein System, das die Menschen unverzüglich und ortsspezifisch vor atomaren Gefahren warnt“, meint der Forscher. Zudem fehle es an „Dekontaminations- und Behandlungskapazitäten für den Massenanfall“. Dombrowsky: „Wenn nicht schleunigst realitätsnahe Konzepte erarbeitet werden, sehe ich für den Ernstfall schwarz.“
Ein radikales Umdenken fordert auch Hans-Peter Kröger, Chef des Deutschen Feuerwehrverbands mit 1,3 Millionen Mitgliedern. Die Kameraden kommen bei Atomunfällen an vorderster Front zum Einsatz. Nach dem Schrecknis von Fukushima sollten die Politiker endlich reagieren.
„Ich verlange eine schonungslose Revision der Strukturen und Konzepte für einen funktionierenden Bevölkerungsschutz“, mahnt Kröger. „Weitermachen wie bisher – das geht nicht.“
„Ich habe erhebliche Zweifel, ob das Krisenmanagement im Ernstfall auch nur ansatzweise funktionieren würde“, sagt auch Wolf Dombrowsky, Katastrophenforscher mit Professur an der Steinbeis-Hochschule Berlin.
Zum Bericht gehts hier.
Zitat:
Sie wollten das Schlimmste verhindern – irgendwie. Im Atomkraftwerk Neckarwestheim war ein Brand ausgebrochen. Die Flammen wüteten im Pumpengebäude eines Kühlturms, ein Mitarbeiter wurde vermisst.
In Spezialanzügen und unter schwerem Atemschutz preschten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Gemmrigheim in die Brandzone vor. „Trotz schwierigster Bedingungen“, so steht es im Einsatzbericht, konnte die Gefahr „sehr zeitnah“ gebannt werden. Die Operation sei „einwandfrei“ verlaufen.
Kritik an mangelnden Konzepten
So oder so ähnlich fallen die meisten Bilanzen nach Notfallübungen in Atomkraftwerken aus. Alles habe „reibungslos funktioniert“, heißt es dann. Auf den Ernstfall sei man „gut vorbereitet“.
Das klingt wunderbar beruhigend. Man könnte glauben, selbst die Explosion eines Reaktors stelle für deutsche Krisenmanager kein Problem dar.
Ein fataler Irrtum, warnen Experten. Katastrophenforscher und Rettungskräfte halten das Konzept zum Schutz der Bevölkerung bei atomaren Bedrohungen für eine Farce. Es fehle an Warnsystemen ebenso wie an brauchbaren Plänen für Massenevakuierungen und zur Behandlung von Strahlenopfern.
Den unmöglichen Ernstfall proben
Der von Behörden erweckte Eindruck, jede Havarie sei beherrschbar, mutet angesichts der Erfahrungen früherer Übungen zynisch an. Immer wieder kam es zu Pannen, die im Realfall wohl viele Menschen das Leben gekostet hätten. Dabei wurden nur Szenarien geprobt, die nicht annähernd den Unglücken von Tschernobyl oder Fukushima entsprachen.
„Solche Dimensionen haben bei unseren Vorbereitungen nie eine Rolle gespielt“, kritisiert Hartmut Ziebs, Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbands. Er glaubt, dass dies „politisch so gewollt“ war. „Warum sollte man sich auf einen Fall vorbereiten, von dem es immer hieß, er werde niemals eintreten?“
...
Vorbeugung gegen personellen Notstand
Selbst für Rettungskräfte lässt sich keine Prognose abgeben. Jutta Helmerichs, Leiterin des psychosozialen Krisenmanagements im BBK, rechnet damit, dass etliche Helfer der psychischen Belastung nicht gewachsen sind – und aus Angst um das eigene Leben oder Sorge um die Familie den Dienst verweigern. „Auf wie viele Helfer dann verzichtet werden muss, kann nicht vorhergesagt werden“, so Helmerichs.
Ein personeller Notstand bei den Rettern wäre das Letzte, was ein Land im Ausnahmezustand gebrauchen kann. Deshalb bieten Bund und Länder spezielle Fortbildungen für Einsatzkräfte an, die bei atomaren Unglücken ausrücken müssen. Auch die Verantwortlichen in den Krisenstäben sollen künftig besser geschult werden.
Pläne liegen in Schubladen
Im Moment jedoch, warnt der Katastrophenforscher Wolf Dombrowsky, sei Deutschland auf atomare Schadensfälle „nicht ausreichend vorbereitet“. Das Schutzkonzept für die Bevölkerung sei teilweise „lückenhaft und grobschlächtig“, es gebe „kaum geeignete Antworten“ auf Fragen, die sich nach einer Tragödie wie in Japan stellen. „Ich habe erhebliche Zweifel, ob das bestehende Krisenmanagement im Ernstfall auch nur ansatzweise funktionieren würde.“
Zwar lägen viele Pläne in den Schubladen. Doch mit „Tabu-Denken und politischer Rücksichtnahme“ hätten die Verantwortlichen einen „wirksamen Bevölkerungsschutz vor atomaren Gefahren bislang blockiert“, so Dombrowsky.
Deutschland brauche dringend „ein System, das die Menschen unverzüglich und ortsspezifisch vor atomaren Gefahren warnt“, meint der Forscher. Zudem fehle es an „Dekontaminations- und Behandlungskapazitäten für den Massenanfall“. Dombrowsky: „Wenn nicht schleunigst realitätsnahe Konzepte erarbeitet werden, sehe ich für den Ernstfall schwarz.“
Ein radikales Umdenken fordert auch Hans-Peter Kröger, Chef des Deutschen Feuerwehrverbands mit 1,3 Millionen Mitgliedern. Die Kameraden kommen bei Atomunfällen an vorderster Front zum Einsatz. Nach dem Schrecknis von Fukushima sollten die Politiker endlich reagieren.
„Ich verlange eine schonungslose Revision der Strukturen und Konzepte für einen funktionierenden Bevölkerungsschutz“, mahnt Kröger. „Weitermachen wie bisher – das geht nicht.“
„Ich habe erhebliche Zweifel, ob das Krisenmanagement im Ernstfall auch nur ansatzweise funktionieren würde“, sagt auch Wolf Dombrowsky, Katastrophenforscher mit Professur an der Steinbeis-Hochschule Berlin.
... link (0 Kommentare) ... comment
Freitag, 13. Mai 2011
Vertuschung in AKW Biblis A
klauslange,22:17h
Von der Vertuschung einer schweren Panne im AKW Biblis A berichtet scinexx hier.
Die Umweltorganisation Greenpeace hat von einem Mitarbeiter des Kernkraftwerks Biblis A interne Dokumente ehralten, die eine nicht dokumentierte technische Panne belegen. Das zugespielte Protokoll beschreibt, wie die innere Reaktordruckbehälter-Dichtung beim Anfahren des Reaktors am 20. Oktober 2010 undicht wurde und zu hohem Druck in der Reaktordruckbehälter-Doppelringdichtung führte. Nur die äußere Deckeldichtung des 37 Jahre alten Reaktors konnte ein Leck verhindern.
Panne nicht ghemeldet
Im Jahr 2010 wurde die Anlage bereits zwei Mal wegen Wartungsarbeiten und Überprüfungen vom Netz genommen. Als am 20. Oktober der vorliegende Mangel auftrat, wurde jedoch weder die Anlage herunter gefahren, noch erscheint der Vorfall in der Liste der meldepflichtigen Ereignisse des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS). Unbekannt ist zudem, ob der Schaden vom Kraftwerksbetreiber RWE behoben wurde.
„Der Reaktordruckbehälter ist das Herzstück des Atomreaktors. Hier darf eine defekte Dichtung nicht ignoriert werden. Ein plötzliches Versagen des Reaktordruckbehälters könnte zu radioaktivem Dampf im Sicherheitsbehälter führen", sagt Heinz Smital, Atomphysiker von Greenpeace. „In der deutschen Atomindustrie ist es jedoch gängige Praxis, Störfälle nicht zu melden und Wirtschaftlichkeit vor Sicherheit zu setzen."
Nicht der erste Zwischenfall
Das Atomkraftwerk Biblis A ist für seine Sicherheitsdefizite bekannt. Der Anfang der 1970er Jahre in Betrieb genommene Reaktorblock geriet vor allem im Dezember 1987 in die Schlagzeilen, als ein defektes Ventil den Austritt von radioaktivem Kühlwasser verursachte. Nur durch Glück gelang es, das Kontrollventil gegen den hohen Druck wieder zu schließen und den Verlust noch größerer Mengen Kühlmittel zu vermeiden. Ein Kühlmittelverlust kann zur Kernschmelze und damit zum Super-GAU führen. Die Störung wurde zwar fristgerecht an die Behörden gemeldet, an die Öffentlichkeit gelangte die Information darüber jedoch erst, als eine amerikanische Fachzeitschrift ein Jahr später darüber berichtete.
Gegenwärtig bewertet die Reaktorsicherheitskommission (RSK) die Sicherheit deutscher Atomkraftwerke. Sie wird ihren Bericht am kommenden Montag der Ethikkommission vorlegen. Der jetzt aufgedeckte Defekt in Biblis A könnte theoretisch in allen deutschen Atomreaktoren auftreten. Nach Auffassung von Greenpeace würden viele Risken der Atomkraft bisher unterbewertet. Die RSK müsse daher alle Risken, auch das von möglichen Terror-Anschlägen, in ihre Untersuchungen aufnehmen.
Die Umweltorganisation Greenpeace hat von einem Mitarbeiter des Kernkraftwerks Biblis A interne Dokumente ehralten, die eine nicht dokumentierte technische Panne belegen. Das zugespielte Protokoll beschreibt, wie die innere Reaktordruckbehälter-Dichtung beim Anfahren des Reaktors am 20. Oktober 2010 undicht wurde und zu hohem Druck in der Reaktordruckbehälter-Doppelringdichtung führte. Nur die äußere Deckeldichtung des 37 Jahre alten Reaktors konnte ein Leck verhindern.
Panne nicht ghemeldet
Im Jahr 2010 wurde die Anlage bereits zwei Mal wegen Wartungsarbeiten und Überprüfungen vom Netz genommen. Als am 20. Oktober der vorliegende Mangel auftrat, wurde jedoch weder die Anlage herunter gefahren, noch erscheint der Vorfall in der Liste der meldepflichtigen Ereignisse des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS). Unbekannt ist zudem, ob der Schaden vom Kraftwerksbetreiber RWE behoben wurde.
„Der Reaktordruckbehälter ist das Herzstück des Atomreaktors. Hier darf eine defekte Dichtung nicht ignoriert werden. Ein plötzliches Versagen des Reaktordruckbehälters könnte zu radioaktivem Dampf im Sicherheitsbehälter führen", sagt Heinz Smital, Atomphysiker von Greenpeace. „In der deutschen Atomindustrie ist es jedoch gängige Praxis, Störfälle nicht zu melden und Wirtschaftlichkeit vor Sicherheit zu setzen."
Nicht der erste Zwischenfall
Das Atomkraftwerk Biblis A ist für seine Sicherheitsdefizite bekannt. Der Anfang der 1970er Jahre in Betrieb genommene Reaktorblock geriet vor allem im Dezember 1987 in die Schlagzeilen, als ein defektes Ventil den Austritt von radioaktivem Kühlwasser verursachte. Nur durch Glück gelang es, das Kontrollventil gegen den hohen Druck wieder zu schließen und den Verlust noch größerer Mengen Kühlmittel zu vermeiden. Ein Kühlmittelverlust kann zur Kernschmelze und damit zum Super-GAU führen. Die Störung wurde zwar fristgerecht an die Behörden gemeldet, an die Öffentlichkeit gelangte die Information darüber jedoch erst, als eine amerikanische Fachzeitschrift ein Jahr später darüber berichtete.
Gegenwärtig bewertet die Reaktorsicherheitskommission (RSK) die Sicherheit deutscher Atomkraftwerke. Sie wird ihren Bericht am kommenden Montag der Ethikkommission vorlegen. Der jetzt aufgedeckte Defekt in Biblis A könnte theoretisch in allen deutschen Atomreaktoren auftreten. Nach Auffassung von Greenpeace würden viele Risken der Atomkraft bisher unterbewertet. Die RSK müsse daher alle Risken, auch das von möglichen Terror-Anschlägen, in ihre Untersuchungen aufnehmen.
... link (0 Kommentare) ... comment
Donnerstag, 12. Mai 2011
Neudatierung der Chronologie Israels
klauslange,22:58h
Bislang wird mehrheitlich die biblische Geschichte der Landnahme Israels und die darauffolgende Chronik von der Archäologie angezweifelt. Dies hängt mit der bisherigen Datierung der Erdschichten in Palästina und einer ägyptischer Inbschrift zusammen, in der Israel erstmals erwähnt wird.
Nun haben Forscher eine weitere Inschrift identifiziert, die das gesamte Geschehen um mindestens zwei Jahrhunderte weiter in die Vergangenheit verlegt und damit auch besfestigte Städte wie Jericho etc. nun korrekt in der Chronologie der Erdschichten liegen.
Spektrum der Wissenschaft berichtet hier.
Zitate:
Geht es nach einem Team deutscher Bibelarchäologen, lagert im Berliner Ägyptischen Museum eine lange übersehene, mausgraue Kostbarkeit. Auf einem verwitterten Granitblock haben sich in Hieroglyphenschrift drei Namen erhalten – zwei sind gut lesbar, der dritte an den entscheidenden Stellen zerbröselt. Doch die Forscher sind überzeugt: Er lautet "Israel".
Haben sie Recht, steht der Erforschung der Geschichte Palästinas eine "schwer zu toppende Sensation" ins Haus, meint Stefan Wimmer, Ägyptologe von der Universität München: Nicht nur weil man bislang überhaupt nur eine einzige solche Inschrift kannte, sondern auch weil das Relief in einer Zeit entstanden sein musste, in der man glaubte, dass Israel noch gar nicht existierte.
Die Konsequenzen einer solchen Deutung wären weit reichend. Alles müsste neu überdacht werden: Wie das israelische Volk entstand, wann seine ersten großen Könige lebten. Und auch die Frage nach der Faktizität der biblischen Exodus-Erzählung wäre berührt – vielleicht hat die Geschichte über die Flucht der Israeliten doch einen wahren Kern.
Die Art und Weise wie die Ägypter die drei fein säuberlich nebeneinander angeordneten Namen festhielten, gibt den entscheidenden Hinweis auf das Alter der Inschrift. Fest steht: In dem Jahrhundert, in dem man die ersten Israeliten in Kanaan vermutete, wurde längst nicht mehr so geschrieben wie auf dem Block im Berliner Museum. Die archaische Schreibung ist mindestens zwei Jahrhunderte zu alt für die herkömmliche Chronologie.
Die zwei Stelen
Die richtet sich nach der anderen bekannten Erwähnung Israels aus altägyptischer Zeit: Sie stammt aus der Regierungszeit des Pharaos Merenptah und wurde in etwa um das Jahr 1200 v. Chr verfasst. "Israel ist verwüstet, seine Saat ist nicht mehr", verkündet der Pharao. Und nicht nur Israel: Auch zahlreiche Nachbarn aus dem syrisch-palästinensischen Gebiet bekamen die eiserne Faust des Ägypterkönigs zu spüren, glaubt man der martialischen Inschrift.
Diese kurze Erwähnung auf der 1896 gefundenen Stele gab der Archäologie einen wichtigen Anhaltspunkt zur Datierung der Geburtsstunde Israels. Wenn das Volk im Jahr 1200 v. Chr. vernichtet werden konnte, musste es freilich bereits existiert haben. Die Mehrheit der Wissenschaftler einigte sich schließlich darauf, dass ein Volk namens "Israel" kurz vor Merenptah die Bühne betrat – vermutlich während der Regierung von dessen Vater Ramses II.
Verschiedene Szenarien erklären die Entstehung des Volks zum Beispiel aus bereits ortsansässigen Stämmen. Dass hingegen Proto-Israeliten aus ägyptischer Gefangenschaft auszogen und sich nach langer Wanderschaft in Kanaan zu einem israelischen Volk zusammenschlossen, wie die Bibel berichtet, galt für die Mehrheit der Bibelwissenschaftler als unwahrscheinlich.
Denn nimmt man die biblische Erzählung für bare Münze, und sucht nach Hinweisen auf einen solchen Exodus und die anschließende Landnahme, wird man in den Jahren vor 1200 v. Chr. nicht fündig: Was Archäologen über die Umstände im damaligen Palästina herausfanden, deckt sich nicht oder jedenfalls kaum mit den Schilderungen im Alten Testament. Von stark befestigten Städten ist dort die Rede, die die Flüchtlinge vom Einzug in ihr Gelobtes Land abhielten. Erst als auf göttliche Intervention hin die Mauern Jerichos in sich zusammenstürzten, konnten die Israeliten die Stadt einnehmen, heißt es beispielsweise im 6. Buch Josua. In Grabungen fand sich jedoch nichts davon – nicht einmal Mauern gab es rund um Jericho. Auch andere Schilderungen, wie die Gefangenschaft in Ägypten oder die Königsherrschaft Davids und Sauls, lassen sich nicht mit den archäologischen Befunden in Einklang bringen, wie vor allem der israelische Archäologe Israel Finkelstein von der Universität Tel Aviv in seinem einflussreichen, 2001 erschienenen Buch "Keine Posaunen vor Jericho" darlegte [1].
Doch mit Wiederentdeckung der Berliner Inschrift im Jahr 2001 bekamen plötzlich alternative Szenarien Aufwind. Der Ägyptologe und Schriftexperte Manfred Görg bemerkte als Erster, dass der Name als "Israel" gelesen werden könnte. Auch dass die Inschrift aus einem – nach Sicht des vorherrschenden Modells – viel zu frühen Jahrhundert zu stammen schien, fiel dem heute emeritierten Professor für Alttestamentliche Theologie an der LMU München auf. Doch seine zeitgleich mit Finkelsteins Buch in "Biblische Notizen" veröffentlichte Studie bekam nur wenig Aufmerksamkeit. [2].
Dabei untermauerten sie die frühere Analyse Görgs mit einem weiteren Befund: Bei einer übersehenen Einkerbung dürfte es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um die Krallen eines Geiers handeln. Von dieser am stärksten zerstörten Hieroglyphe hatte der Münchner Forscher zunächst nur den Schnabel ausmachen können, entsprechend unsicher war seine darauf aufbauende Lesung. Nun ist das Forscherteam davon überzeugt: Das letzte kritische Schriftzeichen sei identifiziert und die Frage nach dem Rohtext geklärt. Auch die beiden anderen Namen lassen sich eindeutig lesen: "Kanaan" und "Aschkelon" sind beides Ortsbezeichnungen aus der Gegend des heutigen Israel. Die geografische Zusammenstellung passt also bestens ins Bild, das sich die Forscher machten.
Übersetzungsschwierigkeiten
Stoff für Diskussionen gibt es dennoch: So wie im lateinischen Alphabet für eine originalgetreue Wiedergabe etwa arabischer Städtenamen Buchstaben fehlen, mussten ägyptische Schreiber improvisieren, wenn sie Namen wie "Israel" notierten. Das Altägyptische verfügte über kein eindeutiges "L" und verwendete stattdessen eines von mehreren möglichen "R"-Zeichen. Hinzu kommen weitere Transkriptionsregeln und -gewohnheiten, die sich zudem im Lauf der Zeit immer wieder änderten. Am Ende rekonstruierten Görg und Kollegen eine Schreibung, die man vereinfacht als "I-schra-il" wiedergeben könnte.
Aber haben sie damit Recht? Der Alttestamentler und Nahostarchäologe James Hoffmeier von der Trinity Evangelical Divinity School in Deerfield (US-Bundesstaat Illinois) hatte sich seinerzeit gegen Görgs Deutung ausgesprochen und den Namen als "Ir-schalir", beziehungsweise in Varianten mit l/r-Vertauschungen gelesen. Sein Hauptkritikpunkt richtete sich gegen den Laut "sch": Würde es sich tatsächlich um eine Erwähnung des biblischen Volks handeln, wäre ein "s" zu erwarten – und kein "sch".
In ihrer neuen Veröffentlichung haben die Wissenschaftler diesen Vorwurf zu entkräften versucht. Überlieferte Beispiele würden zeigen, dass "zum einen die Aussprache mit 'sch' durchaus in einigen Dialekten verbreitet war", erklärt van der Veen, "und zum anderen wissen wir nicht, auf welchen Umwegen der ägyptische Schreiber von dem Namen erfahren hat” – womöglich las der Ägypter zum ersten Mal in akkadischen Texten davon, also in einer dritten, wiederum anders verschrifteten Sprache. Kurzum: Dass "Israel" auf der Merenptah-Stele mit "s" geschrieben wurde, bedeutet nicht, dass dies für alle anderen Erwähnungen auch gelten müsste.
Die Ägyptologen- und Alttestamentlerszene sehen sie auf ihrer Seite: "Wir haben mit vielen Experten auf dem Gebiet gesprochen, und niemand hat das kritisiert", sagt van der Veen. Sein Münchner Kollege Stefan Wimmer bestätigt das: "Die Identifizierung mit Israel ist seriös und solide. Es kommt hinzu, dass es keinerlei einleuchtende Alternativen gibt, mit denen der Name in diesem Kontext denn sonst zu verbinden sei."
Denn dass der Pharao, der die Inschrift in Auftrag gab, den Sieg über ein Gehöft mit zum Verwechseln ähnlich klingendem Namen notieren ließ, sei wenig wahrscheinlich, meint auch van der Veen: "Sieht man sich die beiden anderen Namen an, haben wir es hier offensichtlich mit Hauptfeinden Ägyptens zu tun." Für diese Gegend komme daher nur das in der Bibel erwähnte Volk in Betracht.
Doch der eigentliche Knackpunkt ist das Alter des Reliefs. Die eigentümliche Schreibweise lässt den Forschern nur zwei Interpretationen offen: Entweder der Schreiber bediente sich – aus welchen Gründen auch immer – einer damals schon archaischen Schreibung. Oder aber der Schreiber stammte noch aus einer Zeit, als das von ihm gewählte Transkriptionsverfahren gang und gäbe war: der frühen 18. Dynastie, also den Jahren 1540 bis 1400 v. Chr. Genau das glauben van der Veen, Görg und ihre Kollegen. Doch leider gibt es keine naturwissenschaftlichen Datierungsverfahren, die den Fall eindeutig entscheiden könnten. Was bleibt sind einzig Plausibilitätsargumente.
Nun haben Forscher eine weitere Inschrift identifiziert, die das gesamte Geschehen um mindestens zwei Jahrhunderte weiter in die Vergangenheit verlegt und damit auch besfestigte Städte wie Jericho etc. nun korrekt in der Chronologie der Erdschichten liegen.
Spektrum der Wissenschaft berichtet hier.
Zitate:
Geht es nach einem Team deutscher Bibelarchäologen, lagert im Berliner Ägyptischen Museum eine lange übersehene, mausgraue Kostbarkeit. Auf einem verwitterten Granitblock haben sich in Hieroglyphenschrift drei Namen erhalten – zwei sind gut lesbar, der dritte an den entscheidenden Stellen zerbröselt. Doch die Forscher sind überzeugt: Er lautet "Israel".
Haben sie Recht, steht der Erforschung der Geschichte Palästinas eine "schwer zu toppende Sensation" ins Haus, meint Stefan Wimmer, Ägyptologe von der Universität München: Nicht nur weil man bislang überhaupt nur eine einzige solche Inschrift kannte, sondern auch weil das Relief in einer Zeit entstanden sein musste, in der man glaubte, dass Israel noch gar nicht existierte.
Die Konsequenzen einer solchen Deutung wären weit reichend. Alles müsste neu überdacht werden: Wie das israelische Volk entstand, wann seine ersten großen Könige lebten. Und auch die Frage nach der Faktizität der biblischen Exodus-Erzählung wäre berührt – vielleicht hat die Geschichte über die Flucht der Israeliten doch einen wahren Kern.
Die Art und Weise wie die Ägypter die drei fein säuberlich nebeneinander angeordneten Namen festhielten, gibt den entscheidenden Hinweis auf das Alter der Inschrift. Fest steht: In dem Jahrhundert, in dem man die ersten Israeliten in Kanaan vermutete, wurde längst nicht mehr so geschrieben wie auf dem Block im Berliner Museum. Die archaische Schreibung ist mindestens zwei Jahrhunderte zu alt für die herkömmliche Chronologie.
Die zwei Stelen
Die richtet sich nach der anderen bekannten Erwähnung Israels aus altägyptischer Zeit: Sie stammt aus der Regierungszeit des Pharaos Merenptah und wurde in etwa um das Jahr 1200 v. Chr verfasst. "Israel ist verwüstet, seine Saat ist nicht mehr", verkündet der Pharao. Und nicht nur Israel: Auch zahlreiche Nachbarn aus dem syrisch-palästinensischen Gebiet bekamen die eiserne Faust des Ägypterkönigs zu spüren, glaubt man der martialischen Inschrift.
Diese kurze Erwähnung auf der 1896 gefundenen Stele gab der Archäologie einen wichtigen Anhaltspunkt zur Datierung der Geburtsstunde Israels. Wenn das Volk im Jahr 1200 v. Chr. vernichtet werden konnte, musste es freilich bereits existiert haben. Die Mehrheit der Wissenschaftler einigte sich schließlich darauf, dass ein Volk namens "Israel" kurz vor Merenptah die Bühne betrat – vermutlich während der Regierung von dessen Vater Ramses II.
Verschiedene Szenarien erklären die Entstehung des Volks zum Beispiel aus bereits ortsansässigen Stämmen. Dass hingegen Proto-Israeliten aus ägyptischer Gefangenschaft auszogen und sich nach langer Wanderschaft in Kanaan zu einem israelischen Volk zusammenschlossen, wie die Bibel berichtet, galt für die Mehrheit der Bibelwissenschaftler als unwahrscheinlich.
Denn nimmt man die biblische Erzählung für bare Münze, und sucht nach Hinweisen auf einen solchen Exodus und die anschließende Landnahme, wird man in den Jahren vor 1200 v. Chr. nicht fündig: Was Archäologen über die Umstände im damaligen Palästina herausfanden, deckt sich nicht oder jedenfalls kaum mit den Schilderungen im Alten Testament. Von stark befestigten Städten ist dort die Rede, die die Flüchtlinge vom Einzug in ihr Gelobtes Land abhielten. Erst als auf göttliche Intervention hin die Mauern Jerichos in sich zusammenstürzten, konnten die Israeliten die Stadt einnehmen, heißt es beispielsweise im 6. Buch Josua. In Grabungen fand sich jedoch nichts davon – nicht einmal Mauern gab es rund um Jericho. Auch andere Schilderungen, wie die Gefangenschaft in Ägypten oder die Königsherrschaft Davids und Sauls, lassen sich nicht mit den archäologischen Befunden in Einklang bringen, wie vor allem der israelische Archäologe Israel Finkelstein von der Universität Tel Aviv in seinem einflussreichen, 2001 erschienenen Buch "Keine Posaunen vor Jericho" darlegte [1].
Doch mit Wiederentdeckung der Berliner Inschrift im Jahr 2001 bekamen plötzlich alternative Szenarien Aufwind. Der Ägyptologe und Schriftexperte Manfred Görg bemerkte als Erster, dass der Name als "Israel" gelesen werden könnte. Auch dass die Inschrift aus einem – nach Sicht des vorherrschenden Modells – viel zu frühen Jahrhundert zu stammen schien, fiel dem heute emeritierten Professor für Alttestamentliche Theologie an der LMU München auf. Doch seine zeitgleich mit Finkelsteins Buch in "Biblische Notizen" veröffentlichte Studie bekam nur wenig Aufmerksamkeit. [2].
Dabei untermauerten sie die frühere Analyse Görgs mit einem weiteren Befund: Bei einer übersehenen Einkerbung dürfte es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um die Krallen eines Geiers handeln. Von dieser am stärksten zerstörten Hieroglyphe hatte der Münchner Forscher zunächst nur den Schnabel ausmachen können, entsprechend unsicher war seine darauf aufbauende Lesung. Nun ist das Forscherteam davon überzeugt: Das letzte kritische Schriftzeichen sei identifiziert und die Frage nach dem Rohtext geklärt. Auch die beiden anderen Namen lassen sich eindeutig lesen: "Kanaan" und "Aschkelon" sind beides Ortsbezeichnungen aus der Gegend des heutigen Israel. Die geografische Zusammenstellung passt also bestens ins Bild, das sich die Forscher machten.
Übersetzungsschwierigkeiten
Stoff für Diskussionen gibt es dennoch: So wie im lateinischen Alphabet für eine originalgetreue Wiedergabe etwa arabischer Städtenamen Buchstaben fehlen, mussten ägyptische Schreiber improvisieren, wenn sie Namen wie "Israel" notierten. Das Altägyptische verfügte über kein eindeutiges "L" und verwendete stattdessen eines von mehreren möglichen "R"-Zeichen. Hinzu kommen weitere Transkriptionsregeln und -gewohnheiten, die sich zudem im Lauf der Zeit immer wieder änderten. Am Ende rekonstruierten Görg und Kollegen eine Schreibung, die man vereinfacht als "I-schra-il" wiedergeben könnte.
Aber haben sie damit Recht? Der Alttestamentler und Nahostarchäologe James Hoffmeier von der Trinity Evangelical Divinity School in Deerfield (US-Bundesstaat Illinois) hatte sich seinerzeit gegen Görgs Deutung ausgesprochen und den Namen als "Ir-schalir", beziehungsweise in Varianten mit l/r-Vertauschungen gelesen. Sein Hauptkritikpunkt richtete sich gegen den Laut "sch": Würde es sich tatsächlich um eine Erwähnung des biblischen Volks handeln, wäre ein "s" zu erwarten – und kein "sch".
In ihrer neuen Veröffentlichung haben die Wissenschaftler diesen Vorwurf zu entkräften versucht. Überlieferte Beispiele würden zeigen, dass "zum einen die Aussprache mit 'sch' durchaus in einigen Dialekten verbreitet war", erklärt van der Veen, "und zum anderen wissen wir nicht, auf welchen Umwegen der ägyptische Schreiber von dem Namen erfahren hat” – womöglich las der Ägypter zum ersten Mal in akkadischen Texten davon, also in einer dritten, wiederum anders verschrifteten Sprache. Kurzum: Dass "Israel" auf der Merenptah-Stele mit "s" geschrieben wurde, bedeutet nicht, dass dies für alle anderen Erwähnungen auch gelten müsste.
Die Ägyptologen- und Alttestamentlerszene sehen sie auf ihrer Seite: "Wir haben mit vielen Experten auf dem Gebiet gesprochen, und niemand hat das kritisiert", sagt van der Veen. Sein Münchner Kollege Stefan Wimmer bestätigt das: "Die Identifizierung mit Israel ist seriös und solide. Es kommt hinzu, dass es keinerlei einleuchtende Alternativen gibt, mit denen der Name in diesem Kontext denn sonst zu verbinden sei."
Denn dass der Pharao, der die Inschrift in Auftrag gab, den Sieg über ein Gehöft mit zum Verwechseln ähnlich klingendem Namen notieren ließ, sei wenig wahrscheinlich, meint auch van der Veen: "Sieht man sich die beiden anderen Namen an, haben wir es hier offensichtlich mit Hauptfeinden Ägyptens zu tun." Für diese Gegend komme daher nur das in der Bibel erwähnte Volk in Betracht.
Doch der eigentliche Knackpunkt ist das Alter des Reliefs. Die eigentümliche Schreibweise lässt den Forschern nur zwei Interpretationen offen: Entweder der Schreiber bediente sich – aus welchen Gründen auch immer – einer damals schon archaischen Schreibung. Oder aber der Schreiber stammte noch aus einer Zeit, als das von ihm gewählte Transkriptionsverfahren gang und gäbe war: der frühen 18. Dynastie, also den Jahren 1540 bis 1400 v. Chr. Genau das glauben van der Veen, Görg und ihre Kollegen. Doch leider gibt es keine naturwissenschaftlichen Datierungsverfahren, die den Fall eindeutig entscheiden könnten. Was bleibt sind einzig Plausibilitätsargumente.
... link (0 Kommentare) ... comment
Montag, 9. Mai 2011
Stammzellen aus Hautzellen
klauslange,23:30h
Nein, um an Stammzellen forschen zu können, muss man keine Embryonen 'verbrauchen', sprich: Ungeborene Menschen töten.
Wie man auf eine ganz neue Weise aus Hautzellen Stammzellen gewinnen kann, haben in einem Durchbruch amerikanische Forscher gezeigt. N-TV bringt die Meldung: hier.
Forscher haben einen weiteren Weg gefunden, um Haut in Stammzellen zurückzuprogrammieren. Das Verfahren liefert eine größere Ausbeute als bisher. Derzeit schleusen Stammzellforscher oft mehrere Signalproteine oder die Gene dafür in die erwachsenen Zellen. Diese starteten dann ein Genprogramm, in dessen Folge die erwachsenen Haut- zu Stammzellen wurden – eine Art molekularer Jungbrunnen. Der Erfinder des Verfahrens benötigte vor fünf Jahren zunächst vier solcher Gene, inzwischen geht es auch mit weniger.
Die Gruppe um Edward Morrisey von der University of Pennsylvania in Philadelphia beschritt nun einen anderen Weg und unterdrückte die Produktion von Proteinen. Dafür setzten die Forscher kleine "Schnipsel" aus dem Erbmaterial RNA (Ribonukleinsäure) ein. Solche micro-RNAs (miRNA) sind auch natürlicherweise an der Regulierung der Aktivität von Erbanlagen beteiligt. Im Zellkern wird von den Genen auf der DNA eine chemisch sehr ähnliche Kopie in Form von RNA geschaffen. Erst diese wird von der Zelle abgelesen und in Proteine übersetzt. miRNA können sich jedoch an diese langen Bauanleitungen aus RNA anlagern. Daraufhin wird der so entstandene Komplex in der Zelle zerstört. In der Folge entsteht auch das zugehörige Protein nicht mehr.
Mechanismen gezielt außer Kraft gesetzt
Diesen Mechanismus nutzten auch Morrisey und seine Kollegen. Sie ließen in Mäuse- und Menschenzellen gezielt kleine miRNAs entstehen – und setzten damit einige Mechanismen in den Zellen außer Kraft. Diese wurden daraufhin tatsächlich ebenfalls zurückprogrammiert. Auch auf diesem Weg entstanden induzierte pluripotente Stammzellen (iPS). Eines der Details: Es kommt unter anderem darauf an, ein Enzym namens Hdac2 auszuschalten. Es ist daran beteiligt, die Struktur der Chromosomen zu regulieren. Statt also zusätzliche Proteine in die umzuprogrammierenden Zellen zu schleusen, nehmen ihnen die US-Wissenschaftler etwas weg. Zugleich erhöhe dieses Verfahren die Effizienz der Neuprogrammierung um das Hundertfache erklärt das Team, das seine Ergebnisse im Journal "Cell Stem Cell" präsentiert.
Mit den ursprünglich vier Proteinen wurden etwa 20 von 100.000 Zellen zu iPS-Zellen. Mit den miRNA waren es 10.000 von 100.000. "Wir waren sehr überrascht, dass dies gleich beim ersten Experiment funktioniert hat", erklärte Morrisey. "Seine" iPS-Zellen können sich im Labor bereits in viele, vermutlich aber auch in alle rund 200 verschiedenen Zelltypen entwickeln.
Wie man auf eine ganz neue Weise aus Hautzellen Stammzellen gewinnen kann, haben in einem Durchbruch amerikanische Forscher gezeigt. N-TV bringt die Meldung: hier.
Forscher haben einen weiteren Weg gefunden, um Haut in Stammzellen zurückzuprogrammieren. Das Verfahren liefert eine größere Ausbeute als bisher. Derzeit schleusen Stammzellforscher oft mehrere Signalproteine oder die Gene dafür in die erwachsenen Zellen. Diese starteten dann ein Genprogramm, in dessen Folge die erwachsenen Haut- zu Stammzellen wurden – eine Art molekularer Jungbrunnen. Der Erfinder des Verfahrens benötigte vor fünf Jahren zunächst vier solcher Gene, inzwischen geht es auch mit weniger.
Die Gruppe um Edward Morrisey von der University of Pennsylvania in Philadelphia beschritt nun einen anderen Weg und unterdrückte die Produktion von Proteinen. Dafür setzten die Forscher kleine "Schnipsel" aus dem Erbmaterial RNA (Ribonukleinsäure) ein. Solche micro-RNAs (miRNA) sind auch natürlicherweise an der Regulierung der Aktivität von Erbanlagen beteiligt. Im Zellkern wird von den Genen auf der DNA eine chemisch sehr ähnliche Kopie in Form von RNA geschaffen. Erst diese wird von der Zelle abgelesen und in Proteine übersetzt. miRNA können sich jedoch an diese langen Bauanleitungen aus RNA anlagern. Daraufhin wird der so entstandene Komplex in der Zelle zerstört. In der Folge entsteht auch das zugehörige Protein nicht mehr.
Mechanismen gezielt außer Kraft gesetzt
Diesen Mechanismus nutzten auch Morrisey und seine Kollegen. Sie ließen in Mäuse- und Menschenzellen gezielt kleine miRNAs entstehen – und setzten damit einige Mechanismen in den Zellen außer Kraft. Diese wurden daraufhin tatsächlich ebenfalls zurückprogrammiert. Auch auf diesem Weg entstanden induzierte pluripotente Stammzellen (iPS). Eines der Details: Es kommt unter anderem darauf an, ein Enzym namens Hdac2 auszuschalten. Es ist daran beteiligt, die Struktur der Chromosomen zu regulieren. Statt also zusätzliche Proteine in die umzuprogrammierenden Zellen zu schleusen, nehmen ihnen die US-Wissenschaftler etwas weg. Zugleich erhöhe dieses Verfahren die Effizienz der Neuprogrammierung um das Hundertfache erklärt das Team, das seine Ergebnisse im Journal "Cell Stem Cell" präsentiert.
Mit den ursprünglich vier Proteinen wurden etwa 20 von 100.000 Zellen zu iPS-Zellen. Mit den miRNA waren es 10.000 von 100.000. "Wir waren sehr überrascht, dass dies gleich beim ersten Experiment funktioniert hat", erklärte Morrisey. "Seine" iPS-Zellen können sich im Labor bereits in viele, vermutlich aber auch in alle rund 200 verschiedenen Zelltypen entwickeln.
... link (0 Kommentare) ... comment
Sonntag, 8. Mai 2011
Private Raumfahrt auf der Überholspur
klauslange,02:00h
Wie weit in den USA die private Raumfahrt auf der Überholspur ist lässt einmal mehr SpaceX verlauten. Der Eigner wartet mit konkreten Fakten auf, um die steilen Prognosen der Leistungsfähigkeit weiterer Entwicklungen zu untermauern.
Raumfahrer.net berichtet: hier.
Raumfahrer.net berichtet: hier.
... link (0 Kommentare) ... comment
... older stories