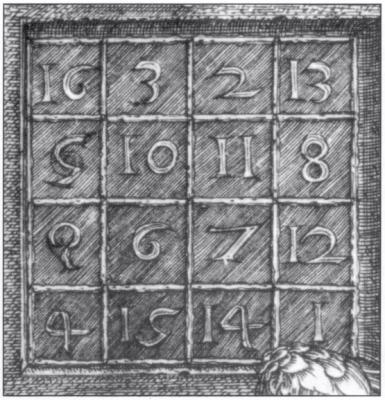Donnerstag, 28. Juni 2012
Angriff auf die Religionsfreiheit
klauslange,18:25h
Wieder einmal ist die Religionsfreiheit angegriffen, und zwar nicht in irgendeinem despotischen Staat, sondern in der Bundesrepublik Deutschland, die verfasst ist auf der freiheitlich demokratischen Grundordnung in der die Religionsfreiheit elementarer Bestandteil ist. Was ist geschehen?
Das Kölner Landgericht urteilte, dass das Beschneidungsritual zur Aufnahme in den Bund Israels gegen die Wahlfreiheit des 8-tägigen kleinen Jungen wäre und die körperliche Unversehrtheit verletzt.
Mit einem solchen Urteil, würde es Bestand haben, würde man in Deutschland wieder das Judentum direkt und an der Wurzel angreifen (und in der Folge auch das Christentum bzgl. Babytaufe zum Beispiel).
Es trifft in Wirklichkeit aber die Religionsfreiheit generell, die dann immer weiter ausgehöhlt wird. Religionsfreiheit im Grundgesetz garantiert nicht nur die Kultfreiheit, sondern auch die Freiheit entsprechend seiner Religion in Frieden ein selbstgestaltetes Leben führen zu dürfen.
Auf welt.de wurde dazu - auch zur Verfassungsrechtsfrage - ein passender Artikel veröffentlicht: hier.
Daraus:
Manch fingerfertiger Kommentator verwandelt sich im Eifer des Gefechts sogar in einen Rabbiner, der seinen Lesern erklärt, die Beschneidung der Jungen im Judentum sei sekundär, was so richtig ist wie die Behauptung, man müsse nicht an Jesus glauben, um Christ zu sein.
Christentum hin, Judentum her. Zum Glück gibt es eine Bibel besonderer Art. In ihr sollte vor allem nachgeschlagen werden: das Grundgesetz. In den Worten von Artikel 4: "Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet."
Gegen das moralische Empfinden
Rechtlich bedeutet diese Art von Freiheit mehr als bloße Toleranz. Welcher Glauben auch immer gemeint ist, die Bundesrepublik fühlte sich bisher verpflichtet, dessen Regeln selbst dann zu schützen, wenn sie das moralische Empfinden eines Teil der Bevölkerung stören.
Vor Jahren wurde etwa ein Vater von vier Kindern verurteilt, dessen Familie Mitglied einer christlichen Sekte war, weil er es abgelehnt hatte, seiner Frau bei der Geburt des letzten Kindes mit einer Bluttransfusion das Leben zu retten. Der Verurteilte ging bis vor das Bundesverfassungsgericht, zitierte aus der Heiligen Schrift "Ist jemand krank, der … lasse über sich beten, und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen" und wurde von den Karlsruher Richtern freigesprochen.
Der Beitritt zum Bund
Folgt man dem Grundgesetz, gehört zum Schutz der Religionen und der verschiedenen Weltanschauungen eben nicht nur die Sicherung kultischer Handlungen, sondern selbst die Garantie einer bestimmten weltanschaulichen Lebensweise. Die Beschneidung der Jungen im Judentum ist aber mehr als das. Sie ist ein grundlegendes, in der Bibel vorgeschriebenes jüdisches Gesetz.
Der Beitritt zum Bund (auf Hebräisch "Berit Mila"), den die Beschneidung vollzieht, gilt als das wichtigste aller Gebote. Sie darf selbst an den höchsten jüdischen Feiertagen vorgenommen werden.
Die Begründung dafür lässt sich im ersten Buch Mose 17,11 finden: "Wenn aber ein Männlicher nicht beschnitten wird an seiner Vorhaut, wird er ausgerottet werden aus seinem Volke, weil er meinen Bund gebrochen hat." Ähnliches findet sich in den Koranauslegungen. Auch sie werden vom Grundgesetz geschützt. Wäre es nicht so, verlöre die Demokratie einen maßgeblichen Teil ihrer westlichen Überzeugungen.
Das Kölner Landgericht urteilte, dass das Beschneidungsritual zur Aufnahme in den Bund Israels gegen die Wahlfreiheit des 8-tägigen kleinen Jungen wäre und die körperliche Unversehrtheit verletzt.
Mit einem solchen Urteil, würde es Bestand haben, würde man in Deutschland wieder das Judentum direkt und an der Wurzel angreifen (und in der Folge auch das Christentum bzgl. Babytaufe zum Beispiel).
Es trifft in Wirklichkeit aber die Religionsfreiheit generell, die dann immer weiter ausgehöhlt wird. Religionsfreiheit im Grundgesetz garantiert nicht nur die Kultfreiheit, sondern auch die Freiheit entsprechend seiner Religion in Frieden ein selbstgestaltetes Leben führen zu dürfen.
Auf welt.de wurde dazu - auch zur Verfassungsrechtsfrage - ein passender Artikel veröffentlicht: hier.
Daraus:
Manch fingerfertiger Kommentator verwandelt sich im Eifer des Gefechts sogar in einen Rabbiner, der seinen Lesern erklärt, die Beschneidung der Jungen im Judentum sei sekundär, was so richtig ist wie die Behauptung, man müsse nicht an Jesus glauben, um Christ zu sein.
Christentum hin, Judentum her. Zum Glück gibt es eine Bibel besonderer Art. In ihr sollte vor allem nachgeschlagen werden: das Grundgesetz. In den Worten von Artikel 4: "Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet."
Gegen das moralische Empfinden
Rechtlich bedeutet diese Art von Freiheit mehr als bloße Toleranz. Welcher Glauben auch immer gemeint ist, die Bundesrepublik fühlte sich bisher verpflichtet, dessen Regeln selbst dann zu schützen, wenn sie das moralische Empfinden eines Teil der Bevölkerung stören.
Vor Jahren wurde etwa ein Vater von vier Kindern verurteilt, dessen Familie Mitglied einer christlichen Sekte war, weil er es abgelehnt hatte, seiner Frau bei der Geburt des letzten Kindes mit einer Bluttransfusion das Leben zu retten. Der Verurteilte ging bis vor das Bundesverfassungsgericht, zitierte aus der Heiligen Schrift "Ist jemand krank, der … lasse über sich beten, und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen" und wurde von den Karlsruher Richtern freigesprochen.
Der Beitritt zum Bund
Folgt man dem Grundgesetz, gehört zum Schutz der Religionen und der verschiedenen Weltanschauungen eben nicht nur die Sicherung kultischer Handlungen, sondern selbst die Garantie einer bestimmten weltanschaulichen Lebensweise. Die Beschneidung der Jungen im Judentum ist aber mehr als das. Sie ist ein grundlegendes, in der Bibel vorgeschriebenes jüdisches Gesetz.
Der Beitritt zum Bund (auf Hebräisch "Berit Mila"), den die Beschneidung vollzieht, gilt als das wichtigste aller Gebote. Sie darf selbst an den höchsten jüdischen Feiertagen vorgenommen werden.
Die Begründung dafür lässt sich im ersten Buch Mose 17,11 finden: "Wenn aber ein Männlicher nicht beschnitten wird an seiner Vorhaut, wird er ausgerottet werden aus seinem Volke, weil er meinen Bund gebrochen hat." Ähnliches findet sich in den Koranauslegungen. Auch sie werden vom Grundgesetz geschützt. Wäre es nicht so, verlöre die Demokratie einen maßgeblichen Teil ihrer westlichen Überzeugungen.
... link (0 Kommentare) ... comment
Donnerstag, 14. Juni 2012
Hildegard von Bingen: Ganzheitlichkeit
klauslange,01:17h
Die sensationelle ganzheitliche Sichtweise von Hildegard von Bingen, die sie als Kirchenlehrerin einbringen wird, zeigt sich u.a. in folgendem Zitat:
“Mitten im Weltenbau steht der Mensch. ... An Statur ist er zwar klein, an Kraft seiner Seele jedoch gewaltig. Sein Haupt nach aufwärts gerichtet, die Füße auf festem Grund, vermag er sowohl die oberen als auch die unteren Dinge in Bewegung zu versetzen. Was er mit seinem Werk in rechter oder linker Hand bewirkt, das durchdringt das All, weil er in der Kraft seines inneren Menschen die Möglichkeit hat, solches ins Werk zu setzen.”
Quelle: De operatione Dei
“Mitten im Weltenbau steht der Mensch. ... An Statur ist er zwar klein, an Kraft seiner Seele jedoch gewaltig. Sein Haupt nach aufwärts gerichtet, die Füße auf festem Grund, vermag er sowohl die oberen als auch die unteren Dinge in Bewegung zu versetzen. Was er mit seinem Werk in rechter oder linker Hand bewirkt, das durchdringt das All, weil er in der Kraft seines inneren Menschen die Möglichkeit hat, solches ins Werk zu setzen.”
Quelle: De operatione Dei
... link (0 Kommentare) ... comment
Montag, 11. Juni 2012
Vatileaks - Fragen und Antworten
klauslange,17:41h
Eigentlich wollte ich hier zum sogenannten Vatileaks gar nichts schreiben, weil ich das alles für viel zu aufgebauscht halte und ich meine Ünterstützung für Papst Benedikt XVI. seit dem Geschrei um die Regensburger Rede hier klar nit einem Logo zum Ausdruck bringe.
Da ich nun aber für meine grundkatholische Haltung bekannt bin und diese ja auch nicht hinter dem Berg halte, möchte ich zum Thema Vatileaks doch einen kath.net Artikel verlinken, in dem Peter Seewald, dessen Interview-Bücher mit Kardinal Ratzinger/Papst Benedikt ich sehr schätze, Stellung bezieht.
Auch diese Bemerkungen von ihm finde ich sehr treffend:
16 Fragen und Antworten
Da ich nun aber für meine grundkatholische Haltung bekannt bin und diese ja auch nicht hinter dem Berg halte, möchte ich zum Thema Vatileaks doch einen kath.net Artikel verlinken, in dem Peter Seewald, dessen Interview-Bücher mit Kardinal Ratzinger/Papst Benedikt ich sehr schätze, Stellung bezieht.
Auch diese Bemerkungen von ihm finde ich sehr treffend:
16 Fragen und Antworten
... link (0 Kommentare) ... comment
Mittwoch, 6. Juni 2012
3000 Jahre alte hebräische Inschrift entziffert
klauslange,20:29h
Eine 2008 gefundene 3000 Jahre alte hebräische Tonscherbeninschrift konnte nun entziffert werden und enthält Rechtsnormen, wie man sie im Alten Testament findet.
Darüber bringt sogar spiegel.de einen Artikel. Das ist deswegen bemerkenswert, weil dieser Fund nun einmal mehr die Texttreue der Bibel aus der damailgen Zeit - etwa 1000 Jahre vor Christus - zeigt, und der Spiegel eher dafür bekannt ist, die jüdisch-christliche Geschichtsschreibung zu bestreiten...
Darüber bringt sogar spiegel.de einen Artikel. Das ist deswegen bemerkenswert, weil dieser Fund nun einmal mehr die Texttreue der Bibel aus der damailgen Zeit - etwa 1000 Jahre vor Christus - zeigt, und der Spiegel eher dafür bekannt ist, die jüdisch-christliche Geschichtsschreibung zu bestreiten...
... link (0 Kommentare) ... comment
Sonntag, 27. Mai 2012
Hildegard von Bingen wird Kirchenlehrerin
klauslange,23:23h
Nun ist es vom Papst bestätigt. Wie er heute bekanntgab wid er Hildegard von Bingen im Oktober zur Kirchenlehrerin erheben.
Das ist eine Sensation. Darüber werde ich später noch viel zu sagen haben.
Kath.net berichtet hier.
Sensationell ist das wegen ihrer ganzheitlichen Sichtweise von der Verknüpfung von Mensch und Kosmos und ihrer heilkundlichen wie theologischen Werke, neben vielem anderen.
Speziell heißt es in der Begründung:
Als Benediktinerin des deutschen Hochmittelalters sei Hildegard eine wahre Meisterin der Theologie und darüber hinaus eine Gelehrte der Naturwissenschaften und der Musik gewesen.
Gerade ihre naturwissenschaftlichen Ansichten machen ihre Werke heute so wertvoll und bilden einen klaren Kontrapunkt zu den auch in kirchlichen Kreisen Einzug gehaltene materialistische Lesart naturwissenschaftlichen Arbeitens.
Mit ihrer formalen Einschreibung in das Heiligenverzeichnis der universalen Kirche hatte sich dieser Schritt abgezeichnet.
Ihre Erhebung zur Kirchenlehrerin kommt einem geistliches Erdbeben gleich!
Das ist eine Sensation. Darüber werde ich später noch viel zu sagen haben.
Kath.net berichtet hier.
Sensationell ist das wegen ihrer ganzheitlichen Sichtweise von der Verknüpfung von Mensch und Kosmos und ihrer heilkundlichen wie theologischen Werke, neben vielem anderen.
Speziell heißt es in der Begründung:
Als Benediktinerin des deutschen Hochmittelalters sei Hildegard eine wahre Meisterin der Theologie und darüber hinaus eine Gelehrte der Naturwissenschaften und der Musik gewesen.
Gerade ihre naturwissenschaftlichen Ansichten machen ihre Werke heute so wertvoll und bilden einen klaren Kontrapunkt zu den auch in kirchlichen Kreisen Einzug gehaltene materialistische Lesart naturwissenschaftlichen Arbeitens.
Mit ihrer formalen Einschreibung in das Heiligenverzeichnis der universalen Kirche hatte sich dieser Schritt abgezeichnet.
Ihre Erhebung zur Kirchenlehrerin kommt einem geistliches Erdbeben gleich!
... link (0 Kommentare) ... comment
Freitag, 11. Mai 2012
Hildegard von Bingen: Heilige der Weltkirche!
klauslange,13:25h
Nun wurde es auch kirchenrechtlich formal korrekt durch einen Rechtsakt Papst Benedikts XVI. besiegelt:
Hildegard von Bingen ist eine Heiliger der Weltkirche!
Dazu ein kath.net Artikel hier.
Da schon letztes Jahr gemu0maßt wurde, dass Hildegard zur Kirchenlehrerin ernannt werden soll, wäre das die formalrechtlich notwendige Vorbedingung dazu. Mal sehen, was das Jahr diesbezüglich noch so bringt...
Hildegard von Bingen ist eine Heiliger der Weltkirche!
Dazu ein kath.net Artikel hier.
Da schon letztes Jahr gemu0maßt wurde, dass Hildegard zur Kirchenlehrerin ernannt werden soll, wäre das die formalrechtlich notwendige Vorbedingung dazu. Mal sehen, was das Jahr diesbezüglich noch so bringt...
... link (0 Kommentare) ... comment
Freitag, 4. Mai 2012
Vatikan: Keine Kompromisse bei Religionsfreiheit und Judentum
klauslange,14:09h
Mit einiger Sorge, dass im Rahmen der Gespräche des Vatikans mit den Pius-Brüdern Errungenschaften des II. Vatikanums insbesondere zur Religionsfreiheit und der Aussöhnung mit dem Judentum teilweise zurückgenommen werden könnten, habe ich die Verhandlungen mit den Pius-Brüdern beobachtet.
Nach Aussage des Bundestagsvizepräsidenten, der sich zu Gesprächen im Vatikan aufhielt, wird der Vatikan gegenüber den Pius-Brüdern in diesen Fragen aber nicht nachgeben. Das berichtet kath.net hier.
Für mich sind diese Fragen von enormer Bedeutung:
Zum einen ist die Religionsfreiheit für mich Ausdruck des Freiraums, den jeder Mensch benötigt, um sich ungezwungen auf der eigenen Suche nach Gott machen zu können. Dies auch, wenn er auf diesem Weg der Suche sich zunächst einmal ein goldenes Kalb anfertigt, um eine vorläufige Antwort auf seine in sich entdeckte natürliche Religiosität zu geben, bis ihm authentisch Christus verkündigt wurde. Dieser Christus kann dabei nicht jenes verzerrte Bild eines moralistischen Sittenwächters sein, sondern nur jener Christus, der ohne Vorbedingung jeden Menschen so liebt, wie er ist. Aus einer solch erfahrenen bedingungslosen Liebe wird sich dann die neue Schöpfung durch Christus in dem Menschen verwirklichen können, um zur wahren Freiheit in Christus zu gelangen.
Zum anderen ist die Aussöhnung mit dem heutigen Judentum auch deswegen wichtig, nicht nur um vergangenes Unrecht und Verfolgung aus dem Raum der Kirche gegen die Juden zu sühnen, sondern um wirklich anzuerkannen, dass der mosaische Bund ein ewiger Bund ist und damit eben klar ist, dass wer sich in ehrlicher Hinwendung zum Gott Israels in dem mosaischen Bund befindet, auch zur Erlösung gelangt - auch heute noch!
Wir Christen glauben zwar, dass diese Erlösung dennoch durch Christus geschieht, aber eben auch auf jene ausstrahlt, die sich noch im Alten Bund, der durch Christus nicht abgschafft wurde, befinden.
Die Pius-Bruderschaft gibt ehrlicherweise klar zu erkennen, dass sie diese beiden Aspekte, die in der Pastoral des zweiten Vatikanums herausgearbeitet wurden und auf der pastoralen Ebene eine Diskontinuität zur bisherigen Tradition darstellen, nicht mittragen. Daher würde ein Kompromiss in dieser Fragen eine Verwirrung zumindest des Kirchenvolkes nach sich ziehen. Sollten die Pius-Brüder in diesen Fragen nicht eingelenkt haben, was nach ihren eigenen Äußerungen nicht geschehen ist, dann kann es auch keine Einigung mit dem Vatikan geben.
Nach Aussage des Bundestagsvizepräsidenten, der sich zu Gesprächen im Vatikan aufhielt, wird der Vatikan gegenüber den Pius-Brüdern in diesen Fragen aber nicht nachgeben. Das berichtet kath.net hier.
Für mich sind diese Fragen von enormer Bedeutung:
Zum einen ist die Religionsfreiheit für mich Ausdruck des Freiraums, den jeder Mensch benötigt, um sich ungezwungen auf der eigenen Suche nach Gott machen zu können. Dies auch, wenn er auf diesem Weg der Suche sich zunächst einmal ein goldenes Kalb anfertigt, um eine vorläufige Antwort auf seine in sich entdeckte natürliche Religiosität zu geben, bis ihm authentisch Christus verkündigt wurde. Dieser Christus kann dabei nicht jenes verzerrte Bild eines moralistischen Sittenwächters sein, sondern nur jener Christus, der ohne Vorbedingung jeden Menschen so liebt, wie er ist. Aus einer solch erfahrenen bedingungslosen Liebe wird sich dann die neue Schöpfung durch Christus in dem Menschen verwirklichen können, um zur wahren Freiheit in Christus zu gelangen.
Zum anderen ist die Aussöhnung mit dem heutigen Judentum auch deswegen wichtig, nicht nur um vergangenes Unrecht und Verfolgung aus dem Raum der Kirche gegen die Juden zu sühnen, sondern um wirklich anzuerkannen, dass der mosaische Bund ein ewiger Bund ist und damit eben klar ist, dass wer sich in ehrlicher Hinwendung zum Gott Israels in dem mosaischen Bund befindet, auch zur Erlösung gelangt - auch heute noch!
Wir Christen glauben zwar, dass diese Erlösung dennoch durch Christus geschieht, aber eben auch auf jene ausstrahlt, die sich noch im Alten Bund, der durch Christus nicht abgschafft wurde, befinden.
Die Pius-Bruderschaft gibt ehrlicherweise klar zu erkennen, dass sie diese beiden Aspekte, die in der Pastoral des zweiten Vatikanums herausgearbeitet wurden und auf der pastoralen Ebene eine Diskontinuität zur bisherigen Tradition darstellen, nicht mittragen. Daher würde ein Kompromiss in dieser Fragen eine Verwirrung zumindest des Kirchenvolkes nach sich ziehen. Sollten die Pius-Brüder in diesen Fragen nicht eingelenkt haben, was nach ihren eigenen Äußerungen nicht geschehen ist, dann kann es auch keine Einigung mit dem Vatikan geben.
... link (2 Kommentare) ... comment
Freitag, 27. April 2012
Richtigstellungen zur sog. Hexenverfolgung
klauslange,13:53h
Als Konvertit von der evangelischen zur katholischen Kirche werde ich manchesmal gefragt, wie ich denn einer Kirche freiwillig angehören kann, die Millionen von Frauen als Hexen verbrannte.
Meine Entgegnung ist stets, dass diese schwarze Legende antikirchlicher Kreise eben nicht der Wahrheit entspricht und gerade als ehemaliger Protestant kann ich dann nicht umhin zu betonen, dass gerade in evangelischen Gebieten die Hexenverfolgung am stärksten war, obwohl auch dort keine Millionen Frauen zu Tode kamen.
Selbstverständlich finde ich, dass schon ein Todes- bzw. Folteropfer genau ein Todes- bzw. Folteropfer zu viel ist, dennoch müssen die historischen Tatsachen richtig gestellt werden.
Zum Thema Hexenverfolgung habe ich heute auf kath.net einen Artikel gefunden, der sich mit meinen Erkenntnissen zu dem Thema deckt und den ich daher hier verlinke.
Daraus:
Die Opfer. Es waren nicht „8 oder 9 Millionen Opfer“, wie die NS-Propaganda vermutete, sondern – nach derzeitigem Forschungsstand – etwa 50.000. In 350 Jahren europäischer Hexenverfolgung (1430-1780). Die Christenverfolgung führt übrigens jedes Jahr zu mehr als doppelt so vielen Opfern.
Die Täter. Rund die Hälfte der 50.000 Opfer lebte auf dem Gebiet des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Wenn man davon ausgeht (und davon darf man aufgrund der Quellenlage wohl ausgehen), dass die Opfer zahlenmäßig zwischen protestantischen und katholischen Gebieten des Reichs ungleich verteilt waren – zu Lasten der protestantischen Gebiete –, dann hat die Katholische Kirche die Verantwortung für etwa 10.000 Todesopfer.
Interessant ist auch der Zusammenhang von Inquisition und Hexenverbrennungen: Nur an einigen hundert der über drei Millionen Hexenprozesse (Schuldspruchquote: 1,5 Prozent) war die Inquisition beteiligt. Die Hexenprozesse fanden in der Tat vor weltlichen Gerichten statt. Die Inquisition interessierte sich nämlich hauptsächlich für Ketzer, nicht für Hexen. Im katholischen Spanien hat es keine Hexenverfolgung gegeben – wegen der Inquisition. Auch in Italien sorgte die Inquisition dafür, dass so gut wie keine Hexe verbrannt wurde. In Rom – dem vermeintlichen Zentrum des Grauens – wurde nie eine Hexe oder ein Zauberer verbrannt. Die Katholische Kirche hat die Hexenverfolgung niemals offiziell bejaht.
„Ja, aber der ,Hexenhammer’!“ Oft wir unterschlagen, wie es eigentlich zu dem berüchtigten „Hexenhammer“ (Malleus Maleficarum, 1486) kam. Heinrich Kramer (Institoris) schrieb ihn, weil er in Innsbruck erfolglos einen Hexenprozess angestrengt und kurz darauf des Landes verwiesen wurde. Von wem? Vom Bischof Georg Golser. Der „Hexenhammer“ ist eine Reaktion darauf gewesen. Die Bulle, auf die sich Kramer in Innsbruck berief, Summis desiderantes affectibus (1484), enthielt im Übrigen die Aufforderung, verdächtige Personen ernsthaft zu prüfen und bei bestätigendem Ergebnis zurechtzuweisen, zu inhaftieren und zu bestrafen – nicht aber, sie zu verbrennen. In der Praxis hat das den Hexenwahn eher gemindert als befördert. Kirchenrechtlich hat die „Hexenbulle“ übrigens nie Bedeutung erlangt, maßgebend war immer der Canon episcopi, der Hexenglaube als Einbildung ablehnte und bis zur Kirchenrechtsreform von 1918 im maßgeblichen CIC enthalten war; „Summis desiderantes affectibus“ taucht dagegen in keinem Verzeichnis auf. Wie gesagt: Die Katholische Kirche war gegen die Hexenverfolgung – im Gegensatz zu Luther und Calvin. Martin Luther war ein Verfechter der Hexenverfolgung, denn er war überzeugt von der Möglichkeit des Teufelspaktes und des Schadenszaubers. In einer Predigt vom 6. Mai 1526 sagte er über Hexen und Zauberer: „Sie schaden mannigfaltig. Also sollen sie getötet werden, nicht allein weil sie schaden, sondern auch, weil sie Umgang mit dem Satan haben.“ – Fairerweise muss man aber sagen, dass sowohl katholische wie auch protestantische Theologen gegen den Hexenwahn angekämpft haben. Neben Jesuiten wie Spee und Laymann etwa Johann Weyer (Konfessionszugehörigkeit umstritten, wahrscheinlich Konvertit) und der reformierte Anton Praetorius.
Das Ende. Interessant ist auch, wie der Hexenwahn – in Europa! – sein Ende fand. Noch einmal Schröder: „Durch die Aufklärung, sagt man. Das stimmt so nicht. Er kam nämlich schon im 17. Jahrhundert weithin zum Erliegen.“ Es gab nämlich massiven Widerstand. „Die Gegner waren Theologen und Juristen, die sich als Christen verstanden.“ Einer davon war der schon erwähnte Friedrich Spee von Langenfeld. 1631 erscheint sein Hauptwerk, die Cautio criminalis („Rechtliches Bedenken wegen der Hexenprozesse“), die nur wenige Woche nach Erscheinen vergriffen ist. In diesem Buch entlarvt er die Hexenprozesse als Farce und die Vollstreckung der Urteile als Mord. Im Zentrum der Kritik steht die Anwendung der Folter, die damals zur Wahrheitsfindung eingesetzt wurde. Spee hält Folter zwar auch für moralisch verwerflich („Kein deutscher Edelmann würde ertragen können, daß man seinen Jagdhund so zerfleischte. Wer soll es da mit ansehen können, daß ein Mensch so vielmals zerrissen wird?“), doch zunächst für juristisch untauglich, weil sie in der Rechtspraxis zur fehlerhaften Beweisaufnahme führe. Friedrich von Spee war übrigens katholisch.
Interessant in dem Zusammenhang, dass offenbar erst 1975 durch die Arbeiten von Norman Cohn und Richard Kieckhefer geklärt wurde, dass die von Etienne Leon de Lamothe-Langon in seiner Histoire de l’Inquisition en France (1829) beschriebenen Massenprozesse und -hinrichtungen im Zuge der Hexenverfolgung im Frankreich des 14.[sic!] Jahrhunderts frei erfunden waren, wie die Mediävistin Jenny Gibbons in einem interessanten Artikel darlegt.
Nachdem die Forschungskommunität anderthalb Jahrhunderte lang keinen Anstoß daran nahm, dass der Verfasser der „Inquisitionsgeschichte in Frankreich“ keine Belege für seine Behauptungen anführt und keine Quellen nennt, ist nun deutlich herausgearbeitet worden, dass man für weitreichende Behauptungen, wie etwa die, dass an einem einzigen Tag 400 Hexen ermordet worden seien, Behauptungen anführen und Quellen nennen sollte. Diese Klärung erfolgte erst, als die Fiktion de Lamothe-Langons längst in der Geschichtsschreibung tradiert war und infolgedessen als unumstößliches Faktum die Stammtische erobert hatte. Wir erinnern uns: Geschichtsbilder werden gemacht.
Meine Entgegnung ist stets, dass diese schwarze Legende antikirchlicher Kreise eben nicht der Wahrheit entspricht und gerade als ehemaliger Protestant kann ich dann nicht umhin zu betonen, dass gerade in evangelischen Gebieten die Hexenverfolgung am stärksten war, obwohl auch dort keine Millionen Frauen zu Tode kamen.
Selbstverständlich finde ich, dass schon ein Todes- bzw. Folteropfer genau ein Todes- bzw. Folteropfer zu viel ist, dennoch müssen die historischen Tatsachen richtig gestellt werden.
Zum Thema Hexenverfolgung habe ich heute auf kath.net einen Artikel gefunden, der sich mit meinen Erkenntnissen zu dem Thema deckt und den ich daher hier verlinke.
Daraus:
Die Opfer. Es waren nicht „8 oder 9 Millionen Opfer“, wie die NS-Propaganda vermutete, sondern – nach derzeitigem Forschungsstand – etwa 50.000. In 350 Jahren europäischer Hexenverfolgung (1430-1780). Die Christenverfolgung führt übrigens jedes Jahr zu mehr als doppelt so vielen Opfern.
Die Täter. Rund die Hälfte der 50.000 Opfer lebte auf dem Gebiet des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Wenn man davon ausgeht (und davon darf man aufgrund der Quellenlage wohl ausgehen), dass die Opfer zahlenmäßig zwischen protestantischen und katholischen Gebieten des Reichs ungleich verteilt waren – zu Lasten der protestantischen Gebiete –, dann hat die Katholische Kirche die Verantwortung für etwa 10.000 Todesopfer.
Interessant ist auch der Zusammenhang von Inquisition und Hexenverbrennungen: Nur an einigen hundert der über drei Millionen Hexenprozesse (Schuldspruchquote: 1,5 Prozent) war die Inquisition beteiligt. Die Hexenprozesse fanden in der Tat vor weltlichen Gerichten statt. Die Inquisition interessierte sich nämlich hauptsächlich für Ketzer, nicht für Hexen. Im katholischen Spanien hat es keine Hexenverfolgung gegeben – wegen der Inquisition. Auch in Italien sorgte die Inquisition dafür, dass so gut wie keine Hexe verbrannt wurde. In Rom – dem vermeintlichen Zentrum des Grauens – wurde nie eine Hexe oder ein Zauberer verbrannt. Die Katholische Kirche hat die Hexenverfolgung niemals offiziell bejaht.
„Ja, aber der ,Hexenhammer’!“ Oft wir unterschlagen, wie es eigentlich zu dem berüchtigten „Hexenhammer“ (Malleus Maleficarum, 1486) kam. Heinrich Kramer (Institoris) schrieb ihn, weil er in Innsbruck erfolglos einen Hexenprozess angestrengt und kurz darauf des Landes verwiesen wurde. Von wem? Vom Bischof Georg Golser. Der „Hexenhammer“ ist eine Reaktion darauf gewesen. Die Bulle, auf die sich Kramer in Innsbruck berief, Summis desiderantes affectibus (1484), enthielt im Übrigen die Aufforderung, verdächtige Personen ernsthaft zu prüfen und bei bestätigendem Ergebnis zurechtzuweisen, zu inhaftieren und zu bestrafen – nicht aber, sie zu verbrennen. In der Praxis hat das den Hexenwahn eher gemindert als befördert. Kirchenrechtlich hat die „Hexenbulle“ übrigens nie Bedeutung erlangt, maßgebend war immer der Canon episcopi, der Hexenglaube als Einbildung ablehnte und bis zur Kirchenrechtsreform von 1918 im maßgeblichen CIC enthalten war; „Summis desiderantes affectibus“ taucht dagegen in keinem Verzeichnis auf. Wie gesagt: Die Katholische Kirche war gegen die Hexenverfolgung – im Gegensatz zu Luther und Calvin. Martin Luther war ein Verfechter der Hexenverfolgung, denn er war überzeugt von der Möglichkeit des Teufelspaktes und des Schadenszaubers. In einer Predigt vom 6. Mai 1526 sagte er über Hexen und Zauberer: „Sie schaden mannigfaltig. Also sollen sie getötet werden, nicht allein weil sie schaden, sondern auch, weil sie Umgang mit dem Satan haben.“ – Fairerweise muss man aber sagen, dass sowohl katholische wie auch protestantische Theologen gegen den Hexenwahn angekämpft haben. Neben Jesuiten wie Spee und Laymann etwa Johann Weyer (Konfessionszugehörigkeit umstritten, wahrscheinlich Konvertit) und der reformierte Anton Praetorius.
Das Ende. Interessant ist auch, wie der Hexenwahn – in Europa! – sein Ende fand. Noch einmal Schröder: „Durch die Aufklärung, sagt man. Das stimmt so nicht. Er kam nämlich schon im 17. Jahrhundert weithin zum Erliegen.“ Es gab nämlich massiven Widerstand. „Die Gegner waren Theologen und Juristen, die sich als Christen verstanden.“ Einer davon war der schon erwähnte Friedrich Spee von Langenfeld. 1631 erscheint sein Hauptwerk, die Cautio criminalis („Rechtliches Bedenken wegen der Hexenprozesse“), die nur wenige Woche nach Erscheinen vergriffen ist. In diesem Buch entlarvt er die Hexenprozesse als Farce und die Vollstreckung der Urteile als Mord. Im Zentrum der Kritik steht die Anwendung der Folter, die damals zur Wahrheitsfindung eingesetzt wurde. Spee hält Folter zwar auch für moralisch verwerflich („Kein deutscher Edelmann würde ertragen können, daß man seinen Jagdhund so zerfleischte. Wer soll es da mit ansehen können, daß ein Mensch so vielmals zerrissen wird?“), doch zunächst für juristisch untauglich, weil sie in der Rechtspraxis zur fehlerhaften Beweisaufnahme führe. Friedrich von Spee war übrigens katholisch.
Interessant in dem Zusammenhang, dass offenbar erst 1975 durch die Arbeiten von Norman Cohn und Richard Kieckhefer geklärt wurde, dass die von Etienne Leon de Lamothe-Langon in seiner Histoire de l’Inquisition en France (1829) beschriebenen Massenprozesse und -hinrichtungen im Zuge der Hexenverfolgung im Frankreich des 14.[sic!] Jahrhunderts frei erfunden waren, wie die Mediävistin Jenny Gibbons in einem interessanten Artikel darlegt.
Nachdem die Forschungskommunität anderthalb Jahrhunderte lang keinen Anstoß daran nahm, dass der Verfasser der „Inquisitionsgeschichte in Frankreich“ keine Belege für seine Behauptungen anführt und keine Quellen nennt, ist nun deutlich herausgearbeitet worden, dass man für weitreichende Behauptungen, wie etwa die, dass an einem einzigen Tag 400 Hexen ermordet worden seien, Behauptungen anführen und Quellen nennen sollte. Diese Klärung erfolgte erst, als die Fiktion de Lamothe-Langons längst in der Geschichtsschreibung tradiert war und infolgedessen als unumstößliches Faktum die Stammtische erobert hatte. Wir erinnern uns: Geschichtsbilder werden gemacht.
... link (0 Kommentare) ... comment
Dienstag, 13. März 2012
Turiner Grabtuch
klauslange,17:00h
Das Turiner Grabtuch ist ein sehr interessanter Gegenstand und mit dafür verantwortlich, dass ich mich solchen anomalen Phänomenen - auch aus dem nichtchristlichen Raum - sehr aufgeschlossen zeige.
Während beim Grabtuch die Radiokarbondatierung noch einmal wiederholt werden muss, diesmal mit Proben aus der Mitte des Tuches und nicht von den Rändern, gibt es auch Forschungen über die Entstehungsart. Hier besagt nun eine Ergebnis, dass sehr hohe Energien erforderlich gewesen sein müssen.
Einem mittelalterkichen Fälscher hätte solche Energien sicher nicht zur Verfügung gestanden und stehen uns heute auch nicht zur Verfügung, um ein so großformaiges Bild zu kreieren.
Kath.net berichtet hier:
Der Wissenschaftler veröffentlichte die Ergebnisse seiner Forschung in einem Artikel im „Journal of Imaging Science and Technology“, wie der „Vatican Insider“ berichtete.
Nach einer ausführlichen Diskussion der Haupttheorien für die Entstehung des Bildes, das man 1898 durch die aufkommende Fotographie auf dem alten Leinentuch entdeckt hatte, folgerte Fanti, dass „es uns die Theorie der Wärmestrahlung erlaubt, näher an die Einzelcharakteristiken des Turiner Grabtuchs heranzukommen, aber sie stellt uns vor ein wichtiges Problem: Nur kleine Sektionen des Bildes, welche in Quadratzenitmetern zu messen sind, können bisher reproduziert werden; ansonsten würden Ressourcen benötigt werden, welche bisher noch nicht in Laboren zur Verfügung stehen“. Die Experimente, welche der Wissenschaftler in Zusammenarbeit mit Professor Giancarlo Pesavento durchgeführt hatte, hatten Stromspannungen um die 500.000 Volt benötigt, um Bilder von wenigen Zentimetern Länge herzustellen, welche dem Grabtuch ähnelten.
Unter den Theorien der Wärmestrahlung, so lautete die Einschätzung des Paduaer Professors, könne nur „der Effekt der Koronarentladung (einer speziellen Form der elektrischen Entladung) eine Antwort auf die charakteristischen Einzelheiten des Abbildes eines Leichnams auf dem Tuch“ bereitstellen. Doch um eine Darstellung in der Größe des Turiner Grabtuchs zu erhalten, brauche es Voltzahlen bis zu zehntausenden Millionen von Volt. Oder man müsste sich außerhalb des Bereichs der Wissenschaft umschauen und das Phänomen mit der Auferstehung verbunden sehen“.
Während beim Grabtuch die Radiokarbondatierung noch einmal wiederholt werden muss, diesmal mit Proben aus der Mitte des Tuches und nicht von den Rändern, gibt es auch Forschungen über die Entstehungsart. Hier besagt nun eine Ergebnis, dass sehr hohe Energien erforderlich gewesen sein müssen.
Einem mittelalterkichen Fälscher hätte solche Energien sicher nicht zur Verfügung gestanden und stehen uns heute auch nicht zur Verfügung, um ein so großformaiges Bild zu kreieren.
Kath.net berichtet hier:
Der Wissenschaftler veröffentlichte die Ergebnisse seiner Forschung in einem Artikel im „Journal of Imaging Science and Technology“, wie der „Vatican Insider“ berichtete.
Nach einer ausführlichen Diskussion der Haupttheorien für die Entstehung des Bildes, das man 1898 durch die aufkommende Fotographie auf dem alten Leinentuch entdeckt hatte, folgerte Fanti, dass „es uns die Theorie der Wärmestrahlung erlaubt, näher an die Einzelcharakteristiken des Turiner Grabtuchs heranzukommen, aber sie stellt uns vor ein wichtiges Problem: Nur kleine Sektionen des Bildes, welche in Quadratzenitmetern zu messen sind, können bisher reproduziert werden; ansonsten würden Ressourcen benötigt werden, welche bisher noch nicht in Laboren zur Verfügung stehen“. Die Experimente, welche der Wissenschaftler in Zusammenarbeit mit Professor Giancarlo Pesavento durchgeführt hatte, hatten Stromspannungen um die 500.000 Volt benötigt, um Bilder von wenigen Zentimetern Länge herzustellen, welche dem Grabtuch ähnelten.
Unter den Theorien der Wärmestrahlung, so lautete die Einschätzung des Paduaer Professors, könne nur „der Effekt der Koronarentladung (einer speziellen Form der elektrischen Entladung) eine Antwort auf die charakteristischen Einzelheiten des Abbildes eines Leichnams auf dem Tuch“ bereitstellen. Doch um eine Darstellung in der Größe des Turiner Grabtuchs zu erhalten, brauche es Voltzahlen bis zu zehntausenden Millionen von Volt. Oder man müsste sich außerhalb des Bereichs der Wissenschaft umschauen und das Phänomen mit der Auferstehung verbunden sehen“.
... link (7 Kommentare) ... comment
Montag, 5. März 2012
Grab in Jerusalem birgt ältestes Zeugnis der Auferstehung
klauslange,13:10h
Ein Grab in Jerusalem aus dem Jahre 70 n. Chr. birgt das bislang älteste Zeugnis der Auferstehung Christi, indem die biblische Geschichte des Jona, der drei Tage im Bauch eines Wales ausharrte, auf Stein skizziert wurde. Die Jona-Geschichte galt den Urchristen als Zeichen der Auferstehung Christi am dritten Tage. Dies berichtet epoc.de hier.
In einem jüdischen Grab stießen Archäologen vermutlich auf die ältesten archäologischen Belege für das Christentum. Auf steinernen Grabkisten aus der Zeit vor 70 n. Chr. fand sich eine griechische Inschrift sowie eine Zeichnung, die nach Ansicht der Forscher die biblische Erzählung um Jona und den Fisch wiedergibt.
Zwar war die in den Fels gehauene Grabstätte schon vor rund 30 Jahren unterhalb eines modernen Gebäudes entdeckt worden, doch erteilte die Israel Antiquities Authority erst 2009 die Erlaubnis, sie mit einer Kamerasonde zu erforschen. Wie die Aufnahmen nun zeigten, gehen von der Grabkammer neun Nischen ab, von denen einige Ossuarien beherbergen. Auf einer dieser Gebeinkisten entdeckte ein Team um den Religionswissenschaftler James D. Tabor von der University of North Carolina at Charlotte die vierzeilige Inschrift, die sich allerdings nicht mehr eindeutig übersetzen lässt. Sicher sei jedoch, dass sie von der Auferstehung Christi handle.
Auf einem weiteren Ossuar glauben die Forscher, die geritzte Darstellung von zahlreichen kleinen und einem großen Fisch zu erkennen. Aus dessen Maul rage ein Männchen, das der Fisch bereits bis auf den Kopf verschlungen hat. Tabor zufolge zeigt das Bild die biblische Geschichte von Jona, der drei Tage und Nächte im Bauch eines großen Fisches ausharrte, bevor dieser ihn wieder ausspie. In den folgenden Jahrhunderten wurde das Motiv häufig an Grabwänden abgebildet, das die frühen Christen als Symbol der Auferstehung Jesu Christi verwendeten. Die Geschichte von Jona und dem Fisch in einem rund 2000 Jahre alten Grab vorzufinden, stellt für James D. Tabor einen erstaunlichen Fund dar: "Ich hielt es für unmöglich, in einem so alten jüdischen Grab ein Ritzbild zu finden, das konkret auf die Auferstehung hinweist."
Überdies galt der Fisch im Urchristentum als Erkennungszeichen, fährt der Religionswissenschaftler fort. Im Judentum sei außerdem die Abbildung von Menschen oder Tieren untersagt gewesen.
Natürlich gibt es auch degegen Widerspruch, aber der Fund mit Zeichnung und Inschrift sind eindeutig.
In einem jüdischen Grab stießen Archäologen vermutlich auf die ältesten archäologischen Belege für das Christentum. Auf steinernen Grabkisten aus der Zeit vor 70 n. Chr. fand sich eine griechische Inschrift sowie eine Zeichnung, die nach Ansicht der Forscher die biblische Erzählung um Jona und den Fisch wiedergibt.
Zwar war die in den Fels gehauene Grabstätte schon vor rund 30 Jahren unterhalb eines modernen Gebäudes entdeckt worden, doch erteilte die Israel Antiquities Authority erst 2009 die Erlaubnis, sie mit einer Kamerasonde zu erforschen. Wie die Aufnahmen nun zeigten, gehen von der Grabkammer neun Nischen ab, von denen einige Ossuarien beherbergen. Auf einer dieser Gebeinkisten entdeckte ein Team um den Religionswissenschaftler James D. Tabor von der University of North Carolina at Charlotte die vierzeilige Inschrift, die sich allerdings nicht mehr eindeutig übersetzen lässt. Sicher sei jedoch, dass sie von der Auferstehung Christi handle.
Auf einem weiteren Ossuar glauben die Forscher, die geritzte Darstellung von zahlreichen kleinen und einem großen Fisch zu erkennen. Aus dessen Maul rage ein Männchen, das der Fisch bereits bis auf den Kopf verschlungen hat. Tabor zufolge zeigt das Bild die biblische Geschichte von Jona, der drei Tage und Nächte im Bauch eines großen Fisches ausharrte, bevor dieser ihn wieder ausspie. In den folgenden Jahrhunderten wurde das Motiv häufig an Grabwänden abgebildet, das die frühen Christen als Symbol der Auferstehung Jesu Christi verwendeten. Die Geschichte von Jona und dem Fisch in einem rund 2000 Jahre alten Grab vorzufinden, stellt für James D. Tabor einen erstaunlichen Fund dar: "Ich hielt es für unmöglich, in einem so alten jüdischen Grab ein Ritzbild zu finden, das konkret auf die Auferstehung hinweist."
Überdies galt der Fisch im Urchristentum als Erkennungszeichen, fährt der Religionswissenschaftler fort. Im Judentum sei außerdem die Abbildung von Menschen oder Tieren untersagt gewesen.
Natürlich gibt es auch degegen Widerspruch, aber der Fund mit Zeichnung und Inschrift sind eindeutig.
... link (0 Kommentare) ... comment
... nächste Seite