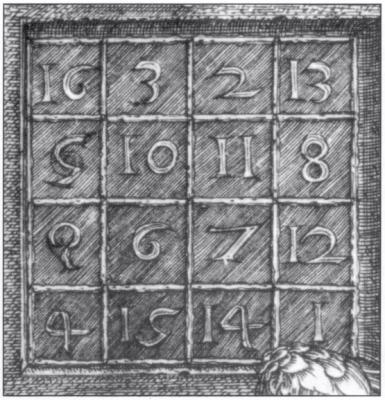Samstag, 5. Juni 2010
Erste Indizien für exotisches Leben auf Titan
klauslange,15:16h
Ohne ein Beweis darzustellen, zeigen erste Analysen einen Stoffkreislauf auf Titan, wie man ihn auch unter Annahme exotischer Lebensformen erwarten würde.
Dies berichten Grenwissenschaft-aktuell
http://grenzwissenschaft-aktuell.blogspot.com/2010/06/wissenschaftler-ratseln-was-verzehrt.html
und zitieren angesehene Peer-Review Journale:
In einer der beiden Studien, die in der Online-Ausgabe des Fachmagazins "Icarus" veröffentlicht wurde, zeigen die Forscher, wie Wasserstoffmoleküle innerhalb der Titan-Atmosphäre niedergehen - auf dessen Oberfläche jedoch merkwürdiger verschwinden.
In der zweiten, im "Journal of Geophysical Research" veröffentlichten Studie kartografierten die Forscher die Verteilung von Kohlenwasserstoffen und stellten dabei das Fehlen von Acetylen fest. "Das Fehlen des Gases ist jedoch von großer Bedeutung, weil es chemisch betrachtet die wahrscheinlichste Energiequelle für Leben auf Methan-Basis auf Titan darstellt", erläutert der Astrobiologe Chris McKay vom kalifornischen "Ames Research Center" der NASA, der schon 2005 eine Reihe von wahrscheinlich für Methan-Leben notwendigen Vorrausetzungen erarbeitet und dargelegt hatte...
Eine mögliche Deutung der gemessenen Acetylen-Daten auf Titan wäre demnach, dass das Gas tatsächlich von Lebensformen auf Titan verzehrt wird. Das Verschwinden des Wasserstoffs, sobald dieser auf der Oberfläche des Saturnmondes ankommt, sei jedoch ein noch wichtigerer Hinweis, da alle Mechanismen möglichen Methan-Lebens auf Titan auch Wasserstoff benötigen würden.
"Wir vermuten einen Verzehr des Wasserstoffs, da es sich um das wahrscheinlichste Lebensgas handelt, das auf Titan konsumiert werden kann, demnach also eine vergleichbare Position auf dem Saturnmond einnimmt, wie Sauerstoff auf der Erde (...) sollten sich diese Hinweise tatsächlich als Zeichen von Leben erweisen, wäre dies gleich doppelt so faszinierend, da es eine zweite, von irdischem auf Wasser basierenden Leben unabhängige, Form von Leben darstellen würde", so McKay...
"Die neuen Auswertungen der Cassini-Daten stimmen zwar mit Bedingungen überein, wie sie exotische, auf Methan basierende Lebensformen entstehen lassen könnten, beweisen jedoch noch nicht deren Existenz", kommentiert der interdisziplinäre Cassni-Wissenschaftler Darrell Strobel von der "Johns Hopkins University in Baltimore" und Co-Autor der Wasserstoff-Studie die Ergebnisse.
Strobel hat die oberen Atmosphären von Saturn und Titan untersucht und dabei ebenfalls auf die Cassini-Daten zurückgegriffen. Seine Studie beschreibt die Dichten von Wasserstoff in den unterschiedlichen Teilen der Atmosphäre und auf der Titan-Oberfläche. Frühere Modelle hatten vorhergesagt, dass Wasserstoffmoleküle, ein Nebenprodukt der ultravioletten Strahlung des Sonnenlichts, die in den oberen Atmosphärenschichten Acetylen und Methanmoleküle aufbricht, in den Schichten der Atmosphäre relativ gleichmäßig verteilt sein sollte. Strobel entdeckte jedoch ein Ungleichgewicht in den Wasserstoffdichten, die einen Abwärtsfluss der Moleküle innerhalb der Atmosphäre bis auf die Titan-Oberfläche belegt: "Es ist so, als spritze Wasserstoff von weit oben in Richtung des Bodens, wo es dann jedoch plötzlich verschwindet. Ein solches Ergebnis hatte ich nicht erwartet, da molekularer Wasserstoff innerhalb der Atmosphäre extrem reaktionsträge, sehr leicht und elastisch ist. Es sollte also in obere Atmosphärenschichten schweben und hier ins All entfliehen." Laut Strobel ist es eher unwahrscheinlich, dass der Wasserstoff in Höhlen oder in Untergrundräumen auf Titan gespeichert werde.
In der Acetylen-Studie untersuchten Wissenschaftler unter Roger Clark von der "U.S. Geological Survey" in Denver die visuellen und Infrarotdaten von Cassini und hatten zuvor erwartet, dass die Sonneneinstrahlung im Zusammenspiel mit Chemikalien in der Titanatmosphäre Acetylen erzeugt, welches dann die Oberfläche des Saturnmondes mit einer Schicht überziehen würde. Stattdessen fand Cassini jedoch keinerlei Hinweise auf das erwartete Gas. Zudem stelle das Spektrometer der Sonde auch die Abwesenheit von Wassereis auf der Titanoberfläche fest - fand jedoch gewaltige Mengen an Benzen (Benzol) und einem anderen Material, bei welchem es sich um eine organische Verbindungen zu handeln scheint, die von den Forschern bislang noch nicht identifiziert werden konnte.
Hier noch ein weiterer Link:
http://www.newscientist.com/article/dn19005-hints-of-life-found-on-saturn-moon.html
Edit:
Nun berichtet auch der Onlinedienst von Bild der Wissenschaft:
http://www.wissenschaft.de/wissenschaft/news/311250.html
Auch astronews.com:
http://www.astronews.com/news/artikel/2010/06/1006-011.shtml
Dies berichten Grenwissenschaft-aktuell
http://grenzwissenschaft-aktuell.blogspot.com/2010/06/wissenschaftler-ratseln-was-verzehrt.html
und zitieren angesehene Peer-Review Journale:
In einer der beiden Studien, die in der Online-Ausgabe des Fachmagazins "Icarus" veröffentlicht wurde, zeigen die Forscher, wie Wasserstoffmoleküle innerhalb der Titan-Atmosphäre niedergehen - auf dessen Oberfläche jedoch merkwürdiger verschwinden.
In der zweiten, im "Journal of Geophysical Research" veröffentlichten Studie kartografierten die Forscher die Verteilung von Kohlenwasserstoffen und stellten dabei das Fehlen von Acetylen fest. "Das Fehlen des Gases ist jedoch von großer Bedeutung, weil es chemisch betrachtet die wahrscheinlichste Energiequelle für Leben auf Methan-Basis auf Titan darstellt", erläutert der Astrobiologe Chris McKay vom kalifornischen "Ames Research Center" der NASA, der schon 2005 eine Reihe von wahrscheinlich für Methan-Leben notwendigen Vorrausetzungen erarbeitet und dargelegt hatte...
Eine mögliche Deutung der gemessenen Acetylen-Daten auf Titan wäre demnach, dass das Gas tatsächlich von Lebensformen auf Titan verzehrt wird. Das Verschwinden des Wasserstoffs, sobald dieser auf der Oberfläche des Saturnmondes ankommt, sei jedoch ein noch wichtigerer Hinweis, da alle Mechanismen möglichen Methan-Lebens auf Titan auch Wasserstoff benötigen würden.
"Wir vermuten einen Verzehr des Wasserstoffs, da es sich um das wahrscheinlichste Lebensgas handelt, das auf Titan konsumiert werden kann, demnach also eine vergleichbare Position auf dem Saturnmond einnimmt, wie Sauerstoff auf der Erde (...) sollten sich diese Hinweise tatsächlich als Zeichen von Leben erweisen, wäre dies gleich doppelt so faszinierend, da es eine zweite, von irdischem auf Wasser basierenden Leben unabhängige, Form von Leben darstellen würde", so McKay...
"Die neuen Auswertungen der Cassini-Daten stimmen zwar mit Bedingungen überein, wie sie exotische, auf Methan basierende Lebensformen entstehen lassen könnten, beweisen jedoch noch nicht deren Existenz", kommentiert der interdisziplinäre Cassni-Wissenschaftler Darrell Strobel von der "Johns Hopkins University in Baltimore" und Co-Autor der Wasserstoff-Studie die Ergebnisse.
Strobel hat die oberen Atmosphären von Saturn und Titan untersucht und dabei ebenfalls auf die Cassini-Daten zurückgegriffen. Seine Studie beschreibt die Dichten von Wasserstoff in den unterschiedlichen Teilen der Atmosphäre und auf der Titan-Oberfläche. Frühere Modelle hatten vorhergesagt, dass Wasserstoffmoleküle, ein Nebenprodukt der ultravioletten Strahlung des Sonnenlichts, die in den oberen Atmosphärenschichten Acetylen und Methanmoleküle aufbricht, in den Schichten der Atmosphäre relativ gleichmäßig verteilt sein sollte. Strobel entdeckte jedoch ein Ungleichgewicht in den Wasserstoffdichten, die einen Abwärtsfluss der Moleküle innerhalb der Atmosphäre bis auf die Titan-Oberfläche belegt: "Es ist so, als spritze Wasserstoff von weit oben in Richtung des Bodens, wo es dann jedoch plötzlich verschwindet. Ein solches Ergebnis hatte ich nicht erwartet, da molekularer Wasserstoff innerhalb der Atmosphäre extrem reaktionsträge, sehr leicht und elastisch ist. Es sollte also in obere Atmosphärenschichten schweben und hier ins All entfliehen." Laut Strobel ist es eher unwahrscheinlich, dass der Wasserstoff in Höhlen oder in Untergrundräumen auf Titan gespeichert werde.
In der Acetylen-Studie untersuchten Wissenschaftler unter Roger Clark von der "U.S. Geological Survey" in Denver die visuellen und Infrarotdaten von Cassini und hatten zuvor erwartet, dass die Sonneneinstrahlung im Zusammenspiel mit Chemikalien in der Titanatmosphäre Acetylen erzeugt, welches dann die Oberfläche des Saturnmondes mit einer Schicht überziehen würde. Stattdessen fand Cassini jedoch keinerlei Hinweise auf das erwartete Gas. Zudem stelle das Spektrometer der Sonde auch die Abwesenheit von Wassereis auf der Titanoberfläche fest - fand jedoch gewaltige Mengen an Benzen (Benzol) und einem anderen Material, bei welchem es sich um eine organische Verbindungen zu handeln scheint, die von den Forschern bislang noch nicht identifiziert werden konnte.
Hier noch ein weiterer Link:
http://www.newscientist.com/article/dn19005-hints-of-life-found-on-saturn-moon.html
Edit:
Nun berichtet auch der Onlinedienst von Bild der Wissenschaft:
http://www.wissenschaft.de/wissenschaft/news/311250.html
Auch astronews.com:
http://www.astronews.com/news/artikel/2010/06/1006-011.shtml
... link (0 Kommentare) ... comment
Samstag, 2. Januar 2010
Mars Phönix Lander: Erste Ergebnisse
klauslange,11:42h
Oft gibt es so viele interessante und parallel laufende Projekte, dass man nie richtig in die Tiefe gehen kann, um die Ergebnisse zu sichten.
Bezüglich des Mars Phönix Landers hat dies nun raumfahrer.net in vorbildlicher Weise getan. Auf zwei Seiten werden kompakt die Resultate zusammengefasst:
http://www.raumfahrer.net/astronomie/planetmars/resultate_phoenix_1.shtml
http://www.raumfahrer.net/astronomie/planetmars/resultate_phoenix_2.shtml
Daten und Bilder werden fachkundig präsentiert.
Einige Aussagen seien hier dokumentiert:
In Bezug auf Temperatur und atmosphärischem Druck kann Wasser auf dem Mars unter den gegebenen Umständen normalerweise lediglich in fester oder gasförmiger Form vorkommen. Perchlorat ist jedoch nicht nur in hohem Maße wasserbindend und könnte somit die knapp bemessene Luftfeuchtigkeit im Boden halten, es ist zudem in einer hohen Konzentration auch ein äußerst effektives "Frostschutzmittel". Bei einer hohen Beimischung von Perchlorat-Salzen wäre es somit denkbar, dass Wasser unter den vorhandenen atmosphärischen Bedingungen noch bis zu einer Temperatur von minus 70 °C flüssig bleibt. Dies, so Nilton Renno von der University of Michigan, würde bedeuten, dass sich nur wenige Zentimeter unter der Oberfläche flüssige Salzwasserfilme bilden könnten. Seine Kollegin Hanna G. Sizemore von der University of Colorado sagt dazu: "Diffusion ist wahrscheinlich der primäre Mechanismus, um in der heutigen Epoche des Mars Wasser in die oberflächennahe Regolithschicht zu transportieren. Lokale Zonen oberflächennahen Eises weisen dabei auf einen Wassertransport durch dünne Wasserfilme hin." Das Perchlorat würde in diesem Falle den Wasserdampf aus der Atmosphäre an sich binden. Dieser würde in den flüssigen Aggregatzustand übergehen und auch über einen längeren Zeitraum in diesem verbleiben...
Mit dem jahreszeitlich bedingten Abfallen der nächtlichen Temperaturen konnte zudem mit fortschreitender Missionsdauer eine Zunahme der Luftfeuchtigkeit registriert werden. Ab etwa dem 80sten Tag der Mission wurde mit dem LIDAR die regelmäßige Bildung von Nebel bis in eine Höhe von etwa 700 Metern beobachtet. Ungefähr ab Sol 90 bildeten sich schließlich bei nächtlichen Tiefsttemperaturen von unter minus 84 Grad Celsius Wolken aus Wassereiskristallen. Dies geschah jeweils in der zweiten Nachthälfte in einer Höhe von etwa vier Kilometern über dem Boden. Später vielen aus diesen Wolken sogenannte Fallschleppen ab. Ähnliche Strukturen sind auch aus der irdischen Meteorologie bekannt und treten auf der Erde zum Beispiel im Zusammenhang mit Zirruswolken auf. Auf dem Mars entstehen sie durch anfangs in ihrer Größe anwachsende Wassereispartikel. Sobald diese Eiskristalle ein bestimmtes Gewicht erreicht haben, fallen sie ab. Es "schneit" Eiskristalle, welche langsam zum Boden hinabgleiten...
"Vor der Phoenix-Mission", so James Whiteway, welcher ebenfalls am der York University tätig und für die entsprechenden LIDAR-Messungen verantwortlich ist, "waren wir uns nicht sicher, ob es auf dem Mars überhaupt irgendwelche Niederschläge gibt. Im Winter breitet sich das nordpolare Eis zwar bis über den Landeplatz von Phoenix aus. Wie das Wasser aber aus der Atmosphäre auf den Boden gelangt, war bislang unklar. Jetzt wissen wir, dass es dort schneit, und dass dieser Schneefall ein Teil des marsianischen Wasserkreislaufs darstellt." Im Laufe der Nacht wandelt sich der Wasserdampf zu Wassereis, was zu einem Verminderung des Luftdrucks führt. In der zweiten Nachthälfte gelangt das Eis auf die Oberfläche und sublimiert dort am nächsten Morgen bei wieder ansteigenden Tagestemperaturen. Der Wasserdampf wird anschließend umgehend in der Atmosphäre verteilt, bevor der Zyklus in der folgenden Nacht erneut einsetzt...
Ein dritter Teil der Artikelserie erscheint in ca. einer Woche und wird auch hier besprochen.
Dem kommt eine starke Bedeutung auch deswegen zu, weil eventuell in diesem Jahr Phönix seine Arbeit wieder aufnehmen könnte. Diese Erwartung wurde von einigen Tagen geschürt, wie astronews.com berichtete:
http://www.astronews.com/news/artikel/2009/12/0912-032.shtml
Bezüglich des Mars Phönix Landers hat dies nun raumfahrer.net in vorbildlicher Weise getan. Auf zwei Seiten werden kompakt die Resultate zusammengefasst:
http://www.raumfahrer.net/astronomie/planetmars/resultate_phoenix_1.shtml
http://www.raumfahrer.net/astronomie/planetmars/resultate_phoenix_2.shtml
Daten und Bilder werden fachkundig präsentiert.
Einige Aussagen seien hier dokumentiert:
In Bezug auf Temperatur und atmosphärischem Druck kann Wasser auf dem Mars unter den gegebenen Umständen normalerweise lediglich in fester oder gasförmiger Form vorkommen. Perchlorat ist jedoch nicht nur in hohem Maße wasserbindend und könnte somit die knapp bemessene Luftfeuchtigkeit im Boden halten, es ist zudem in einer hohen Konzentration auch ein äußerst effektives "Frostschutzmittel". Bei einer hohen Beimischung von Perchlorat-Salzen wäre es somit denkbar, dass Wasser unter den vorhandenen atmosphärischen Bedingungen noch bis zu einer Temperatur von minus 70 °C flüssig bleibt. Dies, so Nilton Renno von der University of Michigan, würde bedeuten, dass sich nur wenige Zentimeter unter der Oberfläche flüssige Salzwasserfilme bilden könnten. Seine Kollegin Hanna G. Sizemore von der University of Colorado sagt dazu: "Diffusion ist wahrscheinlich der primäre Mechanismus, um in der heutigen Epoche des Mars Wasser in die oberflächennahe Regolithschicht zu transportieren. Lokale Zonen oberflächennahen Eises weisen dabei auf einen Wassertransport durch dünne Wasserfilme hin." Das Perchlorat würde in diesem Falle den Wasserdampf aus der Atmosphäre an sich binden. Dieser würde in den flüssigen Aggregatzustand übergehen und auch über einen längeren Zeitraum in diesem verbleiben...
Mit dem jahreszeitlich bedingten Abfallen der nächtlichen Temperaturen konnte zudem mit fortschreitender Missionsdauer eine Zunahme der Luftfeuchtigkeit registriert werden. Ab etwa dem 80sten Tag der Mission wurde mit dem LIDAR die regelmäßige Bildung von Nebel bis in eine Höhe von etwa 700 Metern beobachtet. Ungefähr ab Sol 90 bildeten sich schließlich bei nächtlichen Tiefsttemperaturen von unter minus 84 Grad Celsius Wolken aus Wassereiskristallen. Dies geschah jeweils in der zweiten Nachthälfte in einer Höhe von etwa vier Kilometern über dem Boden. Später vielen aus diesen Wolken sogenannte Fallschleppen ab. Ähnliche Strukturen sind auch aus der irdischen Meteorologie bekannt und treten auf der Erde zum Beispiel im Zusammenhang mit Zirruswolken auf. Auf dem Mars entstehen sie durch anfangs in ihrer Größe anwachsende Wassereispartikel. Sobald diese Eiskristalle ein bestimmtes Gewicht erreicht haben, fallen sie ab. Es "schneit" Eiskristalle, welche langsam zum Boden hinabgleiten...
"Vor der Phoenix-Mission", so James Whiteway, welcher ebenfalls am der York University tätig und für die entsprechenden LIDAR-Messungen verantwortlich ist, "waren wir uns nicht sicher, ob es auf dem Mars überhaupt irgendwelche Niederschläge gibt. Im Winter breitet sich das nordpolare Eis zwar bis über den Landeplatz von Phoenix aus. Wie das Wasser aber aus der Atmosphäre auf den Boden gelangt, war bislang unklar. Jetzt wissen wir, dass es dort schneit, und dass dieser Schneefall ein Teil des marsianischen Wasserkreislaufs darstellt." Im Laufe der Nacht wandelt sich der Wasserdampf zu Wassereis, was zu einem Verminderung des Luftdrucks führt. In der zweiten Nachthälfte gelangt das Eis auf die Oberfläche und sublimiert dort am nächsten Morgen bei wieder ansteigenden Tagestemperaturen. Der Wasserdampf wird anschließend umgehend in der Atmosphäre verteilt, bevor der Zyklus in der folgenden Nacht erneut einsetzt...
Ein dritter Teil der Artikelserie erscheint in ca. einer Woche und wird auch hier besprochen.
Dem kommt eine starke Bedeutung auch deswegen zu, weil eventuell in diesem Jahr Phönix seine Arbeit wieder aufnehmen könnte. Diese Erwartung wurde von einigen Tagen geschürt, wie astronews.com berichtete:
http://www.astronews.com/news/artikel/2009/12/0912-032.shtml
... link (1 Kommentar) ... comment
Mittwoch, 9. Dezember 2009
Mars: Weitere abiologische Quelle von Methan widerlegt
klauslange,18:55h
Seit Methanvorkommen in der Marsatmospäre gefunden wurde, rätselt man über die Quelle, wobei ein biologischer Ursprung als Möglichkeit erachtet wird.
Deneben gab es aber auch drei nicht-biologische Möglichkeiten:
-Aktiver Vulkanismus
-Meteoriteneinschläge
-Vulkangestein in Verbindung mit Wasser
Während aktiver Vulkanismus als Quelle derzeitiger Methanvorkommen ausgeschlossen werden konnte, war die Theorie bzgl. Meteoriteneinschläge als Quelle weitgehend anerkannt. Genau diese Quelle konnte nun aber ausgeschlossen werden, wie eine neueste Studie belegt.
Im Bericht von raumfahrer.net heißt es dazu:
Als auffüllende Ressource erhielt über die letzten Jahre hinweg die These der methanbringenden Meteoriten großen Zuspruch, wonach die auftretende Reibungshitze während des Atmosphärendurchflugs eine chemische Reaktion auslöst, welche zur Freisetzung von Methan und anderen Gasen in die Marsatmosphäre beiträgt.
Im Lichte einer neu angestellten numerischen Simulationsrechnung, sowie spektroskopischer Untersuchungen im besonderen Hinblick auf verschiedenste infrarot-optische Eigenschaften allerdings, lässt sich diese Arbeitshypothese nicht mehr aufrecht erhalten, da die auf diese Weise erzielbaren Volumina nicht ausreichen, um die aktuelle Methankonzentration in der Planetenatmosphäre über die notwendigen Zeiträume hinweg beibehalten zu können. Unter Berücksichtigung der bekannten durchschnittlichen Meteoriten-Fallraten des Mars, lassen sich maximal 10 kg/Jahr des auf diese Weise produzierten Methangases annehmen, weit unterhalb der jährlich global benötigten 150 Tonnen.
Da der Gedanke des geochemischen Ursprungs des Marsmethans (z.B. durch vulkanische Aktivitäten) aus ähnlichen Gründen jüngst ebenfalls verworfen werden musste, reduzieren sich verbleibende Lösungsansätze auf nur noch zwei plausible Theorien: Entweder ist der Methangehalt des Mars vor metabolischen Gesichtspunkten zu sehen, oder aber das CH4 ist ein reaktantes Nebenprodukt chemischer Vorgänge zwischen Vulkangestein und Wasser. Denn sofern in Wasser gelöstes Kohlendioxid mit Silikaten bzw. Inselsilikaten, den sogenannten Olivinen, in Kontakt kommt, entsteht aus dieser Verbindung Wasserstoff, der wiederum mit dem vorhandenen Kohlendioxid reagiert und als Resultat CH4 hervorbringt. In der Gegenwart von Wasser und CO2 werden Minerale auf dem Mars also in der Form verändert, dass eine auf diese Weise stattfindende Methanproduktion ebenfalls denkbar wird.
Mit diesen nunmehr zwei verbliebenen Hypothesen lassen sich auch die Planungen des jetzt für 2018 (allerdings schon häufiger verschobenen) erwarteten NASA/ESA Marsexperimentes im Rahmen der ExoMars-Kampagne zum Methanursprung weitergehend konkretisieren.
Die Liste der möglichen Methanquellen für den Mars wird also kleiner und kleiner. Und spannenderweise verbleibt extraterrestrisches Leben weiterhin als Option auf ihr.
Quelle:
http://www.raumfahrer.net/news/astronomie/09122009112014.shtml
Deneben gab es aber auch drei nicht-biologische Möglichkeiten:
-Aktiver Vulkanismus
-Meteoriteneinschläge
-Vulkangestein in Verbindung mit Wasser
Während aktiver Vulkanismus als Quelle derzeitiger Methanvorkommen ausgeschlossen werden konnte, war die Theorie bzgl. Meteoriteneinschläge als Quelle weitgehend anerkannt. Genau diese Quelle konnte nun aber ausgeschlossen werden, wie eine neueste Studie belegt.
Im Bericht von raumfahrer.net heißt es dazu:
Als auffüllende Ressource erhielt über die letzten Jahre hinweg die These der methanbringenden Meteoriten großen Zuspruch, wonach die auftretende Reibungshitze während des Atmosphärendurchflugs eine chemische Reaktion auslöst, welche zur Freisetzung von Methan und anderen Gasen in die Marsatmosphäre beiträgt.
Im Lichte einer neu angestellten numerischen Simulationsrechnung, sowie spektroskopischer Untersuchungen im besonderen Hinblick auf verschiedenste infrarot-optische Eigenschaften allerdings, lässt sich diese Arbeitshypothese nicht mehr aufrecht erhalten, da die auf diese Weise erzielbaren Volumina nicht ausreichen, um die aktuelle Methankonzentration in der Planetenatmosphäre über die notwendigen Zeiträume hinweg beibehalten zu können. Unter Berücksichtigung der bekannten durchschnittlichen Meteoriten-Fallraten des Mars, lassen sich maximal 10 kg/Jahr des auf diese Weise produzierten Methangases annehmen, weit unterhalb der jährlich global benötigten 150 Tonnen.
Da der Gedanke des geochemischen Ursprungs des Marsmethans (z.B. durch vulkanische Aktivitäten) aus ähnlichen Gründen jüngst ebenfalls verworfen werden musste, reduzieren sich verbleibende Lösungsansätze auf nur noch zwei plausible Theorien: Entweder ist der Methangehalt des Mars vor metabolischen Gesichtspunkten zu sehen, oder aber das CH4 ist ein reaktantes Nebenprodukt chemischer Vorgänge zwischen Vulkangestein und Wasser. Denn sofern in Wasser gelöstes Kohlendioxid mit Silikaten bzw. Inselsilikaten, den sogenannten Olivinen, in Kontakt kommt, entsteht aus dieser Verbindung Wasserstoff, der wiederum mit dem vorhandenen Kohlendioxid reagiert und als Resultat CH4 hervorbringt. In der Gegenwart von Wasser und CO2 werden Minerale auf dem Mars also in der Form verändert, dass eine auf diese Weise stattfindende Methanproduktion ebenfalls denkbar wird.
Mit diesen nunmehr zwei verbliebenen Hypothesen lassen sich auch die Planungen des jetzt für 2018 (allerdings schon häufiger verschobenen) erwarteten NASA/ESA Marsexperimentes im Rahmen der ExoMars-Kampagne zum Methanursprung weitergehend konkretisieren.
Die Liste der möglichen Methanquellen für den Mars wird also kleiner und kleiner. Und spannenderweise verbleibt extraterrestrisches Leben weiterhin als Option auf ihr.
Quelle:
http://www.raumfahrer.net/news/astronomie/09122009112014.shtml
... link (0 Kommentare) ... comment
Montag, 7. Dezember 2009
Mars: Auch heute flüssiges Wasser möglich
klauslange,16:21h
Nach neuesten Berechnungen von Dietrich Möhlmann vom DLR Zentrum in Berlin gibt es auch heute noch flüssiges Wasser auf dem Mars, das nicht sofort vom gefrorenem in den gasförmigem Zustand übergeht. Dies geschieht bereits wenige Zentimer unter der Eisfläche bis hinab zu gut zehn Metern tiefe. Solche Seen könnten selbstverständlich Leben beherbergen.
New Scientist berichtet:
http://www.newscientist.com/article/mg20427373.700-watery-niche-may-foster-life-on-mars.html
New Scientist berichtet:
http://www.newscientist.com/article/mg20427373.700-watery-niche-may-foster-life-on-mars.html
... link (0 Kommentare) ... comment
Sonntag, 29. November 2009
Also doch: Mars Meteorit beherbergt Lebensspuren
klauslange,13:59h
Dies konnte nun eine neue Studie beweisen, die vorherige Kritiken die Magnetit-Kristalle seien abiotischer Natur ausräumen konnte.
Mal sehen, wenn die Kritiker das nun anerkennen:
http://www.universetoday.com/2009/11/25/new-findings-on-alan-hills-meteorite-point-to-microbial-life/
Siehe dazu auch den Vortrag, den ich bereits am 9. November verlinkte:
http://designale.blogger.de/stories/1525478/
Mal sehen, wenn die Kritiker das nun anerkennen:
http://www.universetoday.com/2009/11/25/new-findings-on-alan-hills-meteorite-point-to-microbial-life/
Siehe dazu auch den Vortrag, den ich bereits am 9. November verlinkte:
http://designale.blogger.de/stories/1525478/
... link (1 Kommentar) ... comment
Mittwoch, 11. November 2009
Astrobiologie im Vatikan
klauslange,15:38h
Eine interessante Konferenz findet im Vatikan bzgl. außerirdischen Lebens statt.
Wie wahrscheinlich ist außerirdisches Leben? Wahrscheinlich findet sich eine Antwort schn in unserem Sonnensystem.
kath.net berichtet:
http://www.kath.net/detail.php?id=24506
Wie wahrscheinlich ist außerirdisches Leben? Wahrscheinlich findet sich eine Antwort schn in unserem Sonnensystem.
kath.net berichtet:
http://www.kath.net/detail.php?id=24506
... link (0 Kommentare) ... comment
Montag, 9. November 2009
ALH84001 und andere Marsmeteorite...
klauslange,21:34h
... werden gut 12 Jahre nach der Pressekonferenz 1996 noch einmal durch David McCay erläutert. Alle die damals bis 1999 vorgebrachten Gegenargumente, dass dort im Zusammenspiel aller Entdeckungen Lebenshinterlassenschaften zu sehen sind, konnten sehr deutlich ausgeräumt werden. Für mich steht mindestens zu 95% fest, dass Fossile marsianischen Lebens in diesem und anderen Meteorite vom Mars nachgewiesen wurden. Grund: Mittlerweile steht fest, dass die Carbonate auch mit niedrige Temperaturen entstanden sein können und wahrscheinlich auch sind, zuvor war das der Killingpoint, weil gedacht wurde, es ginge nur in hohen Temperaturen.
Hier der Vortrag:
http://academicearth.org/lectures/ALH-84001
Hier der Vortrag:
http://academicearth.org/lectures/ALH-84001
... link (0 Kommentare) ... comment
Mittwoch, 21. Oktober 2009
Jupitermond Europa: Wahrscheinlichkeit für komplexes Leben...
klauslange,18:44h
... steigt!
Wie eine Studie der Messkampagnen zum o.a. Jupitermond ergibt, ist der Ozean unter dem Eispanzer mit genügend Sauerstoff versehen, dass in diesem Gewässer nicht nur Mikroben, sondern sogar komplexe Lebensformen wie Fischer möglich sind.
Zwar spricht zuviel Sauerstoff gegen eine Lebensentstehung in einem solchen Gewässer, aber für schon existierendes Leben ist es ideal.
So sollen auch die ersten Lebensformen auf der Erde weitestgehend ohne Sauerstoff ausgekommen sein, doch ihre Entwicklung ließ dann Sauerstoff im Wasser und der Atmosphäre zunehmen, so dass wir heute die Sauerstoffatmer auf der Erde für den Regelfall halten.
Wenn es also im Ozean des Mondes Europa Leben gibt, dann ist seine Entwicklung schon recht komplex.
Also, nichts wie hin und nachschauen!!!
Quelle:
http://www.weltderphysik.de/de/4245.php?ni=1607
Wie eine Studie der Messkampagnen zum o.a. Jupitermond ergibt, ist der Ozean unter dem Eispanzer mit genügend Sauerstoff versehen, dass in diesem Gewässer nicht nur Mikroben, sondern sogar komplexe Lebensformen wie Fischer möglich sind.
Zwar spricht zuviel Sauerstoff gegen eine Lebensentstehung in einem solchen Gewässer, aber für schon existierendes Leben ist es ideal.
So sollen auch die ersten Lebensformen auf der Erde weitestgehend ohne Sauerstoff ausgekommen sein, doch ihre Entwicklung ließ dann Sauerstoff im Wasser und der Atmosphäre zunehmen, so dass wir heute die Sauerstoffatmer auf der Erde für den Regelfall halten.
Wenn es also im Ozean des Mondes Europa Leben gibt, dann ist seine Entwicklung schon recht komplex.
Also, nichts wie hin und nachschauen!!!
Quelle:
http://www.weltderphysik.de/de/4245.php?ni=1607
... link (0 Kommentare) ... comment
Freitag, 24. Juli 2009
Wieder ein Lebenskandidat im Sonnensystem
klauslange,12:06h
Neben dem Jupitermond Europa, der einen verborgenen Ozean unter seiner Eisoberfläche besitzt, und Titan des Saturn fällt auch zunehmend Enceladus als mögliche Lebensherberge auf.
Neueste Ergbenisse, die Ammoniak nachweisen konnten, aber auch viele andere organische Moleküle, zeigen klare Belege indirekter Natur, dass auch dort flüssiges Meer unter Permaeis vorhanden ist.
astronews.com berichtet:
http://www.astronews.com/news/artikel/2009/07/0907-033.shtml
Daraus:
Ammoniak wirkt als Frostschutzmittel und kann den Gefrierpunkt von Wasser auf fast bis zu minus 100 Grad Celsius absenken. Cassini hat in der Umgebung der Bruchstellen, aus denen die Fontänen stammen, leicht höhere Temperaturen gemessen. "Wir glauben, dass wir hier ein ausgezeichnetes Argument für flüssiges Wasser im Inneren des Mondes haben", meint auch Hunter Waite vom Southwest Research Institute in San Antonio, Texas, der verantwortliche Wissenschaftler für das Spektrometer an Bord von Cassini.
Der Nachweis einer beträchtlichen Menge von Argon 40, einem Argon-Isotop, das beim Zerfall von Kalium entsteht, ist nach Ansicht der Wissenschaftler ein weiteres Indiz für flüssiges Wasser. Vermutlich sei flüssiges Wasser, das durch den steinigen Kern des Mondes zirkuliert, für den Argon 40-Anteil verantwortlich. Argon 40 wird auf der Erde beispielsweise aus Gesteinen freigesetzt.
Darüber hinaus entdeckte das Team zahlreiche Kohlenstoff-haltige Moleküle wie Methan, Formaldehyd, Ethanol und verschiedene Kohlenwasserstoffe. Erst vor kurzem wurde zudem Natrium und Kalium im E-Ring des Saturn gefunden, der aus Material von Enceladus besteht. Dies würde darauf hindeuten, dass es eine salzige und flüssige Schicht im Inneren des Saturnmondes gibt. Enceladus wäre deswegen "ein recht guter Ort für Leben", so Lunine.
"Ich glaube das wirklich Interessante ist, dass wir nun vier Orte im äußeren Sonnensystem mit unterirdischen Ozeanen haben," meint der Wissenschaftler und bezieht sich dabei außer auf Enceladus noch auf den Saturnmond Titan sowie die Jupitertrabanten Europa und Ganymed. Auch für die Suche nach außerirdischem Leben, so Lunine, würde Enceladus damit zu einem vielversprechenden Untersuchungsobjekt - neben Mars, Titan und Europa.
Dieser Einschätzung schließe ich mich an. Nur meine ich auch, dass wir in der Venus-Atmosphäre durchaus auf Schwefelbasis bestehende Mikroben finden könnten. Wir leben nicht nur auf einen Planeten des Lebens, sondern sind teil eines Sonnensystems des Lebens, dessen Basen und Interkationen - Panspermie und Reversepanspermie - über das gesamte Sonnensystem verteilt sind... Nun muss das nur noch einer direkt nachweisen. Die Raumfahrt böte dafür vielfältige Möglichkeiten.
Neueste Ergbenisse, die Ammoniak nachweisen konnten, aber auch viele andere organische Moleküle, zeigen klare Belege indirekter Natur, dass auch dort flüssiges Meer unter Permaeis vorhanden ist.
astronews.com berichtet:
http://www.astronews.com/news/artikel/2009/07/0907-033.shtml
Daraus:
Ammoniak wirkt als Frostschutzmittel und kann den Gefrierpunkt von Wasser auf fast bis zu minus 100 Grad Celsius absenken. Cassini hat in der Umgebung der Bruchstellen, aus denen die Fontänen stammen, leicht höhere Temperaturen gemessen. "Wir glauben, dass wir hier ein ausgezeichnetes Argument für flüssiges Wasser im Inneren des Mondes haben", meint auch Hunter Waite vom Southwest Research Institute in San Antonio, Texas, der verantwortliche Wissenschaftler für das Spektrometer an Bord von Cassini.
Der Nachweis einer beträchtlichen Menge von Argon 40, einem Argon-Isotop, das beim Zerfall von Kalium entsteht, ist nach Ansicht der Wissenschaftler ein weiteres Indiz für flüssiges Wasser. Vermutlich sei flüssiges Wasser, das durch den steinigen Kern des Mondes zirkuliert, für den Argon 40-Anteil verantwortlich. Argon 40 wird auf der Erde beispielsweise aus Gesteinen freigesetzt.
Darüber hinaus entdeckte das Team zahlreiche Kohlenstoff-haltige Moleküle wie Methan, Formaldehyd, Ethanol und verschiedene Kohlenwasserstoffe. Erst vor kurzem wurde zudem Natrium und Kalium im E-Ring des Saturn gefunden, der aus Material von Enceladus besteht. Dies würde darauf hindeuten, dass es eine salzige und flüssige Schicht im Inneren des Saturnmondes gibt. Enceladus wäre deswegen "ein recht guter Ort für Leben", so Lunine.
"Ich glaube das wirklich Interessante ist, dass wir nun vier Orte im äußeren Sonnensystem mit unterirdischen Ozeanen haben," meint der Wissenschaftler und bezieht sich dabei außer auf Enceladus noch auf den Saturnmond Titan sowie die Jupitertrabanten Europa und Ganymed. Auch für die Suche nach außerirdischem Leben, so Lunine, würde Enceladus damit zu einem vielversprechenden Untersuchungsobjekt - neben Mars, Titan und Europa.
Dieser Einschätzung schließe ich mich an. Nur meine ich auch, dass wir in der Venus-Atmosphäre durchaus auf Schwefelbasis bestehende Mikroben finden könnten. Wir leben nicht nur auf einen Planeten des Lebens, sondern sind teil eines Sonnensystems des Lebens, dessen Basen und Interkationen - Panspermie und Reversepanspermie - über das gesamte Sonnensystem verteilt sind... Nun muss das nur noch einer direkt nachweisen. Die Raumfahrt böte dafür vielfältige Möglichkeiten.
... link (0 Kommentare) ... comment
Dienstag, 7. Juli 2009
Wetterphänomene auf dem Mars
klauslange,18:49h
Vor einiger Zeit wurde berichtet, dass es auf dem Mars zwar schneit, aber der Boden nicht vom Niederschlag erreicht wird. Nun konnte auch das nachgewiesen werden, wie astronews berichtet:
http://www.astronews.com/news/artikel/2009/07/0907-008.shtml
Daraus:
In den frühen Morgenstunden rieseln Eiskristalle aus dünnen Wolken bis auf die Oberfläche des roten Planeten herab. Diesen Vorgang konnte ein internationales Forscherteam mithilfe eines speziellen Lasers an Bord der amerikanischen Marssonde Phoenix erstmals beobachten. Am Tag verdampft das Wasser und bildet dann wieder neue Wolken. Das Team berichtet im Fachblatt Science über seine Messungen.
"Vor der Phoenix-Mission wussten wir nicht, ob es auf dem Mars überhaupt Niederschläge gibt", erklärt James Whiteway von der York University in Toronto, der die Messungen geleitet hat. "Im Winter breitet sich das polare Eis zwar bis zum Landeplatz von Phoenix aus, aber wie das Wasser aus der Atmosphäre zum Boden gelangt, war bislang unklar. Jetzt wissen wir, dass es dort schneit, und dass dieser Schneefall ein Teil des Wasserkreislaufs auf dem Mars ist."
Dadurch klärt sich auch eine frühere Meldung, die sogar flüssiges Kondens-Wasser an Phönix kundete, erklären:
http://www.astronews.com/news/artikel/2009/02/0902-025.shtml
Ferner und unabhängig davon, konnte marsianisches Blitzlicht aufgenommen werden, das in Staubwirbel entsteht:
http://www.astronews.com/news/artikel/2009/06/0906-039.shtml
Sozusagen ein marsianisches Gewitter. Natürlich durfte hier der Verweis auf die Lebensentstehung nicht fehlen, doch ist das viel zu spekulativ. Insgesamt bleibt aber festzuhalten, dass der Mars sein vorher staubtrockenes und totes Gesicht, oder was die Wissenschaft dafür hielt, deutlich verändert hat. Der Mars ist ein dynamischer Planet und wird noch viele neue Facetten zeigen. Dabei behalten wir die Methan-Vorkommen in der Atmosphäre unseres Nachbarplaneten im Hinterkopf...
http://www.astronews.com/news/artikel/2009/07/0907-008.shtml
Daraus:
In den frühen Morgenstunden rieseln Eiskristalle aus dünnen Wolken bis auf die Oberfläche des roten Planeten herab. Diesen Vorgang konnte ein internationales Forscherteam mithilfe eines speziellen Lasers an Bord der amerikanischen Marssonde Phoenix erstmals beobachten. Am Tag verdampft das Wasser und bildet dann wieder neue Wolken. Das Team berichtet im Fachblatt Science über seine Messungen.
"Vor der Phoenix-Mission wussten wir nicht, ob es auf dem Mars überhaupt Niederschläge gibt", erklärt James Whiteway von der York University in Toronto, der die Messungen geleitet hat. "Im Winter breitet sich das polare Eis zwar bis zum Landeplatz von Phoenix aus, aber wie das Wasser aus der Atmosphäre zum Boden gelangt, war bislang unklar. Jetzt wissen wir, dass es dort schneit, und dass dieser Schneefall ein Teil des Wasserkreislaufs auf dem Mars ist."
Dadurch klärt sich auch eine frühere Meldung, die sogar flüssiges Kondens-Wasser an Phönix kundete, erklären:
http://www.astronews.com/news/artikel/2009/02/0902-025.shtml
Ferner und unabhängig davon, konnte marsianisches Blitzlicht aufgenommen werden, das in Staubwirbel entsteht:
http://www.astronews.com/news/artikel/2009/06/0906-039.shtml
Sozusagen ein marsianisches Gewitter. Natürlich durfte hier der Verweis auf die Lebensentstehung nicht fehlen, doch ist das viel zu spekulativ. Insgesamt bleibt aber festzuhalten, dass der Mars sein vorher staubtrockenes und totes Gesicht, oder was die Wissenschaft dafür hielt, deutlich verändert hat. Der Mars ist ein dynamischer Planet und wird noch viele neue Facetten zeigen. Dabei behalten wir die Methan-Vorkommen in der Atmosphäre unseres Nachbarplaneten im Hinterkopf...
... link (0 Kommentare) ... comment
... nächste Seite