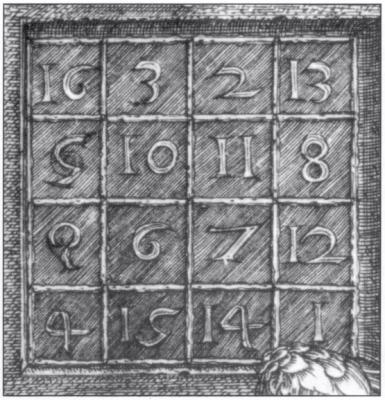Freitag, 10. August 2012
Higgs-Mechanismus in Magneten
klauslange,16:17h
In einem Magneten konnte nun ein analoger Fall zum Higgs-Mechanismus für Elementarteilchen beobachtet werden: Monopole, die keine Masse besitzen, konnten sich bei einer sehr tiefen Temperatur nahe dem absoluten Nullpunkt plötzlich ausrichten. Dies war nur dadurch möglich, dass diesen Monopole eine Masse zugewiesen wurde entdprechend dem Higgs-Mechanismus. Dazu ein Artikel auf pro physik.
... link (0 Kommentare) ... comment
Sonntag, 5. August 2012
Einsteins Formel
klauslange,14:40h
Und nun der eigentliche Grund für die letzten beiden Vorträge. Ahnt schon jemand, worauf ich hinaus will?
... link (0 Kommentare) ... comment
Binomische Formel
klauslange,13:51h
Wieder aus einem bestimmten Grund, nun dieser Vortrag zur binomische Formel:
... link (0 Kommentare) ... comment
Satz des Pythagoras
klauslange,13:11h
Aus einem bestimmten Grund möchte ich diesen sehr guten Vortrag über den Satz des Pythagoras dem Leser anbieten:
... link (0 Kommentare) ... comment
Dienstag, 31. Juli 2012
Stringtheorie: Twistoren Mini-Revolution
klauslange,00:51h
Auf der String2012 Konferenz letzte Woche in München gab es auch einen Vortrag über Fortschritte zur sogenannten Minirevolution durch Twistorenmathematik im Rahmen der Stringtheorie. Interessant sind Twistoren, da sie eigentlich wie die Komplexe Relativitätstheorie den Dimensionen einen komplexwertigen Bestandteil zur Seite stellen-
Übrigens kann ich zeigen, wie im Rahmen der Komplexen Relativität die Stringtheorie bzw. M-Theorie zu ihren Extradimensionen kommt, nur dass diese nicht alles das berücksichtigen können, was die Urwort-Theorie kann, womit der String-/ Branen-Ansatz nur eine unvollständige Näherung an die Urwort-Theorie ist...
Auch mit den Twistoren wird der Stringansatz nicht vollwertig die Zusammenhänge der Urwort-Theorie darstellen können, da ihr schlicht der G^4 fehlt.
Übrigens kann ich zeigen, wie im Rahmen der Komplexen Relativität die Stringtheorie bzw. M-Theorie zu ihren Extradimensionen kommt, nur dass diese nicht alles das berücksichtigen können, was die Urwort-Theorie kann, womit der String-/ Branen-Ansatz nur eine unvollständige Näherung an die Urwort-Theorie ist...
Auch mit den Twistoren wird der Stringansatz nicht vollwertig die Zusammenhänge der Urwort-Theorie darstellen können, da ihr schlicht der G^4 fehlt.
... link (0 Kommentare) ... comment
Freitag, 27. Juli 2012
Komplexe Relativitätstheorie: Heimsche Hermetrieformen, Transdimensionen und ihre physikalische Einbettung
klauslange,13:10h
Im Zusammenhang mit der Heim-Theorie taucht immer wieder der Begriff der 'Hermetrieform' auf und in Abhandlungen, die ins Englische übertragen werden, wird oft eins zu eins 'Hermetryform' übertragen, was zu Verständnisschwierigkeiten führt, wie ich einer Anfrage entnehmen kann.
Der Begriff 'Hermetrieform' ist eine Wortschöpfung von Burkhard Heim und kein mathematisch oder physikalisch eingeführter Begriff. Heim setzte das Wort 'Hermetrie' aus den Worten 'Hermeneutik' und 'Geometrie' zusammen.
Er wollte damit zum Ausdruck bringen, dass es neben den rein syntaktischen Strukturen in der Physik auch semantische Strukturen geben muss, die also bestimmten Größen eine bedeutungsgebende Funktion zuweisen.
Dazu nutzte Heim weitere Koordinaten, und Hermetrieformen sind nichts anderes als ausgewiesene Koordinatengruppen, neben jenen des Raumes und der Zeit. Diese bezeichnen den Informationsbereich I^2 und den Strukturbereich S^2, der herarchie- und ordnungbildend auftritt.
I^2 und S^2 sind bei Heim sogenannte Transdimensionen und nicht mit den Extradimensionen etwa der Stringtheorie zu verwechseln. Aber genau hier liegt auch das Problem: Wie kann man diese Semantik im Rahmen der üblichen physikalischen Beschreibung auffassen?
Hier kommt wieder einmal Michael Königs Urwort-Theorie ins Spiel. Denn Dr. König hat erkannt, dass man diese Transdimensionen I^2 und S^2 mit der Inneren Raumzeit eines Elektrons bei Charons Komplexer Relativitätstheorie gleichsetzen kann. Diese innere Raumzeit besteht aus einer Raum- und dreier Zeitdimension. Ich möchte diese zur Unterscheidung von der äußeren Raumzeit als inverse Raumzeit bezeichnen.
Was wurde dadurch gewonnen? Haben wir nicht mit einer solchen Raumzeit wieder nur eine syntaktische Beschreibung? Nein, denn diese innere Raumzeit ist im Gegensatz zur äußeren Raumzeit, in der wachsende Entropie herrscht, ein negentropischer Bereich und somit ordnungs- und sinnbildend.
Wenn also im Rahmen der Heimschen Theorie einige Hermetrieformen die Transdimensionen I^2 und/oder S^2 enthalten, muss man die innere Raumzeit mitberücksichtigen. Mehr noch: Auch da, wo bislang nur von der Berücksichtigung raumzeitlicher Dimensionen ausgegangen wurde, müssen nun auch die inversen raumzeitlichen Dimensionen zumindest anteilig in den Analysen eingehen. Mit diesem Kunstgriff erweist sich die Urwort-Theorie wieder einmal als die Meta-Theorie für die Ansätze von Heim und Charon.
Der Begriff 'Hermetrieform' ist eine Wortschöpfung von Burkhard Heim und kein mathematisch oder physikalisch eingeführter Begriff. Heim setzte das Wort 'Hermetrie' aus den Worten 'Hermeneutik' und 'Geometrie' zusammen.
Er wollte damit zum Ausdruck bringen, dass es neben den rein syntaktischen Strukturen in der Physik auch semantische Strukturen geben muss, die also bestimmten Größen eine bedeutungsgebende Funktion zuweisen.
Dazu nutzte Heim weitere Koordinaten, und Hermetrieformen sind nichts anderes als ausgewiesene Koordinatengruppen, neben jenen des Raumes und der Zeit. Diese bezeichnen den Informationsbereich I^2 und den Strukturbereich S^2, der herarchie- und ordnungbildend auftritt.
I^2 und S^2 sind bei Heim sogenannte Transdimensionen und nicht mit den Extradimensionen etwa der Stringtheorie zu verwechseln. Aber genau hier liegt auch das Problem: Wie kann man diese Semantik im Rahmen der üblichen physikalischen Beschreibung auffassen?
Hier kommt wieder einmal Michael Königs Urwort-Theorie ins Spiel. Denn Dr. König hat erkannt, dass man diese Transdimensionen I^2 und S^2 mit der Inneren Raumzeit eines Elektrons bei Charons Komplexer Relativitätstheorie gleichsetzen kann. Diese innere Raumzeit besteht aus einer Raum- und dreier Zeitdimension. Ich möchte diese zur Unterscheidung von der äußeren Raumzeit als inverse Raumzeit bezeichnen.
Was wurde dadurch gewonnen? Haben wir nicht mit einer solchen Raumzeit wieder nur eine syntaktische Beschreibung? Nein, denn diese innere Raumzeit ist im Gegensatz zur äußeren Raumzeit, in der wachsende Entropie herrscht, ein negentropischer Bereich und somit ordnungs- und sinnbildend.
Wenn also im Rahmen der Heimschen Theorie einige Hermetrieformen die Transdimensionen I^2 und/oder S^2 enthalten, muss man die innere Raumzeit mitberücksichtigen. Mehr noch: Auch da, wo bislang nur von der Berücksichtigung raumzeitlicher Dimensionen ausgegangen wurde, müssen nun auch die inversen raumzeitlichen Dimensionen zumindest anteilig in den Analysen eingehen. Mit diesem Kunstgriff erweist sich die Urwort-Theorie wieder einmal als die Meta-Theorie für die Ansätze von Heim und Charon.
... link (0 Kommentare) ... comment
Sonntag, 22. Juli 2012
Neue Urwort-Abhandlung: Stop-Squark-Massenabschätzung und Higgs-Boson
klauslange,22:43h
Nun die angekündigte kurze Abhandlung 'Stop-Squark-Massenabschätzung unter Verwendung des Higgs-Bosons im Rahmen der Urwort-Theorie', die ich auch wieder unter Borderlands of Science platzieren werde:
utstophiggs_v1 (pdf, 15 KB)
utstophiggs_v1 (pdf, 15 KB)
... link (0 Kommentare) ... comment
Samstag, 14. Juli 2012
Higgs-Masse im Rahmen der Urwort-Theorie und ihre Konsequenz
klauslange,18:18h
Mit dem Wissen der neu Entdeckten Bosonen-Masse von 126 GeV/c^2 des Higgs-Kandidaten gelangt man zu einem neuen Abschätzungsmechanismus im Rahmen der Urwort-Theorie. Die in meiner Urwort-Abhandlung utsusy_v1 (pdf, 290 KB)
, Abschnitt 4 verwendeten Berechnungsprinzipien kann man auch für die Higgs-Massen-Abschätzung verwenden, wenn man das Vorzeichen der Exponenten ändert (da man nun bei Bosonen bleibt und nicht zu den Fermionen wechselt):
Masse_Z_Boson = 91 GeV/c^2
Masse_W_Boson = 80 GeV/c^2
Faktor analog zu Abschnitt 4
(2^0 + 2^(-1))
Massen-Abschätzung:
Higgsmasse-Obergrenze = 91 GeV * (2^0 + 2^(-1)) = 136,5 GeV/c^2
Higgsmasse-Untergrenze = 80 GeV * (2^0 + 2^(-1)) = 120 GeV/c^2
Massen-Mittelwert = (136,5 GeV/c^2 + 120 GeV/c^2)/2 = (256,5 GeV/c^2 )/2 = 128,25 GeV/c^2
Das hat auch Auswirkung auf meine Massen-Abschätzung für das Stop Squark. Im Wesentlichen führt das zu einer Halbierung, wie ich in einer neuen Abhandlung kurz erläutern werde, da nun auch der Summand 2^1 für V_min erlaubt ist. Das Stop-Squark ist damit unter der o.a. Voraussetzung also auch bei 344 +- 86 GeV/c^2 zu suchen!
Masse_Z_Boson = 91 GeV/c^2
Masse_W_Boson = 80 GeV/c^2
Faktor analog zu Abschnitt 4
(2^0 + 2^(-1))
Massen-Abschätzung:
Higgsmasse-Obergrenze = 91 GeV * (2^0 + 2^(-1)) = 136,5 GeV/c^2
Higgsmasse-Untergrenze = 80 GeV * (2^0 + 2^(-1)) = 120 GeV/c^2
Massen-Mittelwert = (136,5 GeV/c^2 + 120 GeV/c^2)/2 = (256,5 GeV/c^2 )/2 = 128,25 GeV/c^2
Das hat auch Auswirkung auf meine Massen-Abschätzung für das Stop Squark. Im Wesentlichen führt das zu einer Halbierung, wie ich in einer neuen Abhandlung kurz erläutern werde, da nun auch der Summand 2^1 für V_min erlaubt ist. Das Stop-Squark ist damit unter der o.a. Voraussetzung also auch bei 344 +- 86 GeV/c^2 zu suchen!
... link (0 Kommentare) ... comment
Sonntag, 8. Juli 2012
Higgs-Mechanismus und die Bedeutung fundamentaler Skalarfelder
klauslange,15:53h
Persönlich hatte ich stets das Problem, den als Higgs-Mechanismus populär gewordenen Effekt für voll zu nehmen, da man ja auch mit ihm nicht die Werte der vierschiedenen Massen der Elementarteilchen berechnen kann, so auch nicht die Masse des Higgs-Teilchens. Was mich dann aber mit diesem Konzept versöhnt hat und auch erkennen ließ, wie großartig dieser Mechanismus ist, erschloss sich mir aus der Tatache des Meißner-Ochsenfeld-Effekts für Supraleiter.
Um es kurz zu machen: In einem Supraleiter erscheint die Masse des Photons, das ja keine Ruhemasse besitzt, als mit Ruhemasse behaftet und somit wird seine Reichwarte stark beschränkt. Unterhalb der Sprungtemperatur bilden sich im Supraleiter Cooper-Paare, die dann mit den Photonen wechselwirken. Entsprechendes gilt nun für den Higgs-Mechanismus: Alle Bosonen haben bei entsprechend hohen Temperaturen keine Masse. Sinkt diese jeweils hinreichende Temperatur so bilden sich vier Higgsfelder und es kommt zu einer Wechselwirkung zwischen Bosonen und Higgsfeldern. Dadurch verlieren die Bosonen ihre Reichweite und man muss ihnen eine Masse zuschreiben. So weit, so gut: Aber was ist mit dem Photon? Es besitzt ja keine Ruhemasse, ist aber ein Boson. Genau aus diesem Grunde muss es noch ein freies Higgs-Boson geben. Und nach diesem hat man gesucht und es wohl auch gefunden...
Übrigens: Das m.E. Ultraspannende ist bei der ganzen Sache, dass die Higgs-Felder Skalarfelder sein müssen. Denn man müsste ja sonst fragen, woher denn das Higgs-Boson seine Masse hat. Der Higgs-Mechanismus gilt aber für Vektorbosonen. Ein Skalarboson bezieht seine Masse aus dem Potential, während ein Vektorboson dies nicht kann und den Higgs-Mechanismus braucht.
Mit dem Higgsfeld haben wir damit erstmals ein fundamentales Skalarfeld in der Natur indirekt nachgewiesen. Das ist wichtig, denn zum Beispiel das Inflaton-Feld, das für die Inflationsphase der Expansion des Universums verantwortlich zeichnet, ist auch ein Skalarfeld. Doch solange man nicht wusste, dass es fundamentale Skalarfelder in der Natur gibt, war diese skalare Inflaton-Feld-Lösung eher ein Ad-hoc-Postulat. So aber hat das alles eine experimentelle Grundlage. Die Natur nutzt wirklich fundamentale Skalarfelder!
Um es kurz zu machen: In einem Supraleiter erscheint die Masse des Photons, das ja keine Ruhemasse besitzt, als mit Ruhemasse behaftet und somit wird seine Reichwarte stark beschränkt. Unterhalb der Sprungtemperatur bilden sich im Supraleiter Cooper-Paare, die dann mit den Photonen wechselwirken. Entsprechendes gilt nun für den Higgs-Mechanismus: Alle Bosonen haben bei entsprechend hohen Temperaturen keine Masse. Sinkt diese jeweils hinreichende Temperatur so bilden sich vier Higgsfelder und es kommt zu einer Wechselwirkung zwischen Bosonen und Higgsfeldern. Dadurch verlieren die Bosonen ihre Reichweite und man muss ihnen eine Masse zuschreiben. So weit, so gut: Aber was ist mit dem Photon? Es besitzt ja keine Ruhemasse, ist aber ein Boson. Genau aus diesem Grunde muss es noch ein freies Higgs-Boson geben. Und nach diesem hat man gesucht und es wohl auch gefunden...
Übrigens: Das m.E. Ultraspannende ist bei der ganzen Sache, dass die Higgs-Felder Skalarfelder sein müssen. Denn man müsste ja sonst fragen, woher denn das Higgs-Boson seine Masse hat. Der Higgs-Mechanismus gilt aber für Vektorbosonen. Ein Skalarboson bezieht seine Masse aus dem Potential, während ein Vektorboson dies nicht kann und den Higgs-Mechanismus braucht.
Mit dem Higgsfeld haben wir damit erstmals ein fundamentales Skalarfeld in der Natur indirekt nachgewiesen. Das ist wichtig, denn zum Beispiel das Inflaton-Feld, das für die Inflationsphase der Expansion des Universums verantwortlich zeichnet, ist auch ein Skalarfeld. Doch solange man nicht wusste, dass es fundamentale Skalarfelder in der Natur gibt, war diese skalare Inflaton-Feld-Lösung eher ein Ad-hoc-Postulat. So aber hat das alles eine experimentelle Grundlage. Die Natur nutzt wirklich fundamentale Skalarfelder!
... link (0 Kommentare) ... comment
Donnerstag, 5. Juli 2012
LHC: Teilchen mit ca. 125 GeV entdeckt
klauslange,01:20h
Wie schon vorweggenommen, wurde also am LHC ein Teilchen mit ca. 125 GeV entdeckt. Es ist nur noch nicht sicher, ob es sich wirklich um das Standardmodell-Higgs handelt oder doch um ein SM-Higgsartiges Teilchen.
CMS hat insgesamt eine Signifikanz von 4,9 Sigma und ATLAS eine Signifikanz von 5,0 Sigma, so dass schon von daher korrekterweise eine Entdeckung vorliegt.
Interessant ist dabei, dass in beiden Experimenten im Gamma-Gamma Kanal eine viel höhere Energie gemessen wurde, als für das SM-Higgs zu erwarten wäre. Das kann sich noch um eine statistische Fluktuation handeln, es kann aber auch ein Hinweis auf neue Physik sein. Immerhin hat dieser stärkere Ausschlag eine Signifikanz von 2 Sigma. Damit haben auch erste Hinweise begonnen, als es um die Energie eines Teilchens von 125 GeV im Herbst letzten Jahres ging...
Für neue Physik würde auch sprechen, dass beim CMS-Experiment im Tau-Antitau-Kanal kein Ausschlag gesehen wurde, dies aber bei einem SM-Higgs sein müsste. Es bleibt also spannend.
Auf jeden Fall herzliche Gratulation an alle Beteiligten!
CMS hat insgesamt eine Signifikanz von 4,9 Sigma und ATLAS eine Signifikanz von 5,0 Sigma, so dass schon von daher korrekterweise eine Entdeckung vorliegt.
Interessant ist dabei, dass in beiden Experimenten im Gamma-Gamma Kanal eine viel höhere Energie gemessen wurde, als für das SM-Higgs zu erwarten wäre. Das kann sich noch um eine statistische Fluktuation handeln, es kann aber auch ein Hinweis auf neue Physik sein. Immerhin hat dieser stärkere Ausschlag eine Signifikanz von 2 Sigma. Damit haben auch erste Hinweise begonnen, als es um die Energie eines Teilchens von 125 GeV im Herbst letzten Jahres ging...
Für neue Physik würde auch sprechen, dass beim CMS-Experiment im Tau-Antitau-Kanal kein Ausschlag gesehen wurde, dies aber bei einem SM-Higgs sein müsste. Es bleibt also spannend.
Auf jeden Fall herzliche Gratulation an alle Beteiligten!
... link (0 Kommentare) ... comment
... nächste Seite