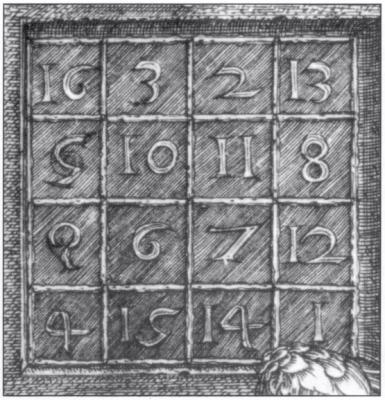Dienstag, 3. Juli 2012
Higgs-Gerüchte
klauslange,18:46h
Bevor nun morgen die offizielle Verlautbarung des Cern abgegeben wird, möchte ich die neuesten Gerüchte besprechen. Es geht dabei um die Signifikanz der 2012er Ergebnisse bezogen auf die einzelnen Detektoren ATLAS und CMS des LHC.
Die Gerüchte gehen nun dahin, dass jedes einzelne Experiment für sich ein 125 GeV Higgs-Teilchen mit einem Sigma größer als 4 sieht, aber eben noch nicht die 5 Sigma erreicht hat. Doch auch so wäre dies schon mehr als ausreichend, denn nehmen wir an beide Experimente hätten jedes für sich 4,1 Sigma erreicht (was sicherlich zu tief gestapelt ist), dann können wir die Gesamtsignifikanz berechnen, indem wir einfach die Einzelsignifikanzen quadrieren, addieren und daraus die Wurzel ziehen:
Sigma_Gesamt = (4,1^2 + 4,1^2)^(1/2) = (33,62)^(1/2) = 5,798...
Was einer gesicherten Entdeckungsgüte von 5 Sigma übersteigt. Aber ich kann schon nachvollziehen, dass man bei einer solch einschneidenden Entdeckung wenigstens in einem der Experimente selbst eine 5 Sigma sehen möchte, bevor man offiziell von einer Entdeckung sprechen wird. Doch das hat eher psychologische und keine physikalisch-technisch-statistischen Gründe...
Die Gerüchte gehen nun dahin, dass jedes einzelne Experiment für sich ein 125 GeV Higgs-Teilchen mit einem Sigma größer als 4 sieht, aber eben noch nicht die 5 Sigma erreicht hat. Doch auch so wäre dies schon mehr als ausreichend, denn nehmen wir an beide Experimente hätten jedes für sich 4,1 Sigma erreicht (was sicherlich zu tief gestapelt ist), dann können wir die Gesamtsignifikanz berechnen, indem wir einfach die Einzelsignifikanzen quadrieren, addieren und daraus die Wurzel ziehen:
Sigma_Gesamt = (4,1^2 + 4,1^2)^(1/2) = (33,62)^(1/2) = 5,798...
Was einer gesicherten Entdeckungsgüte von 5 Sigma übersteigt. Aber ich kann schon nachvollziehen, dass man bei einer solch einschneidenden Entdeckung wenigstens in einem der Experimente selbst eine 5 Sigma sehen möchte, bevor man offiziell von einer Entdeckung sprechen wird. Doch das hat eher psychologische und keine physikalisch-technisch-statistischen Gründe...
... link (0 Kommentare) ... comment
Montag, 25. Juni 2012
Cern: Seminar zu neuen Such-Ergebnissen nach dem Higgs Boson
klauslange,16:43h
In letzter Zeit gibt es ja Gerüchte nach weiteren Hinweisen zur Suche nach dem Higgsboson in den neuen Daten der 2012er Kollisionen am LHC.
Vermutet wurde eine entsprechende Bekanntgabe auf der ICHEP-Konferenz in Melbourne vom 4. bis 11. Juli 2012.
Nun hat das Cern aber mitgeteilt, dass es selbst ein Seminar am 4.7.2012 abhalten will, um weitere Ergebnisse bezüglich der Higgs-Suche öffentlich zu machen (siehe auch hier).
Vermutet wurde eine entsprechende Bekanntgabe auf der ICHEP-Konferenz in Melbourne vom 4. bis 11. Juli 2012.
Nun hat das Cern aber mitgeteilt, dass es selbst ein Seminar am 4.7.2012 abhalten will, um weitere Ergebnisse bezüglich der Higgs-Suche öffentlich zu machen (siehe auch hier).
... link (0 Kommentare) ... comment
Donnerstag, 21. Juni 2012
BaBar: Neue Physik entdeckt
klauslange,01:06h
Während man wieder über neue Ergebnisse mit größerer Signifikanz zum Higgs-Boson spekuliert (und gesicherte Auskunft wird auf der Konferenz in Melbourne zu finden sein, siehe ab 4.7.12 hier) wurde mittels der BaBar-Kollaboration ein Zerfall beobachtet, der viel größer ist, als die Standardtheorie der Teilchenphysik erlaubt. Ausführlich berichtet science daily darüber:
In this type of decay, a particle called the B-bar meson decays into a D meson, an antineutrino and a tau lepton. While the level of certainty of the excess (3.4 sigma in statistical language) is not enough to claim a break from the Standard Model, the results are a potential sign of something amiss and are likely to impact existing theories, including those attempting to deduce the properties of Higgs bosons.
"The excess over the Standard Model prediction is exciting," said BaBar spokesperson Michael Roney, professor at the University of Victoria in Canada. The results are significantly more sensitive than previously published studies of these decays, said Roney. "But before we can claim an actual discovery, other experiments have to replicate it and rule out the possibility this isn't just an unlikely statistical fluctuation."
The BaBar experiment, which collected particle collision data from 1999 to 2008, was designed to explore various mysteries of particle physics, including why the universe contains matter, but no antimatter. The collaboration's data helped confirm a matter-antimatter theory for which two researchers won the 2008 Nobel Prize in Physics.
Researchers continue to apply BaBar data to a variety of questions in particle physics. The data, for instance, has raised more questions about Higgs bosons, which arise from the mechanism thought to give fundamental particles their mass. Higgs bosons are predicted to interact more strongly with heavier particles -- such as the B mesons, D mesons and tau leptons in the BaBar study -- than with lighter ones, but the Higgs posited by the Standard Model can't be involved in this decay.
"If the excess decays shown are confirmed, it will be exciting to figure out what is causing it," said BaBar physics coordinator Abner Soffer, associate professor at Tel Aviv University. Other theories involving new physics are waiting in the wings, but the BaBar results already rule out one important model called the "Two Higgs Doublet Model."
Nun wird noch eine unabhängige Bestätigung benötigt, die aber bald vorliegen kann, wie New Scientist berichtet:
The BaBar team's results are not statistically significant, yet, but they hope a Japanese experiment called Belle will confirm their results soon. If it is confirmed, the standard model may need a revamp, even if the Higgs is discovered to fit neatly into it.
In this type of decay, a particle called the B-bar meson decays into a D meson, an antineutrino and a tau lepton. While the level of certainty of the excess (3.4 sigma in statistical language) is not enough to claim a break from the Standard Model, the results are a potential sign of something amiss and are likely to impact existing theories, including those attempting to deduce the properties of Higgs bosons.
"The excess over the Standard Model prediction is exciting," said BaBar spokesperson Michael Roney, professor at the University of Victoria in Canada. The results are significantly more sensitive than previously published studies of these decays, said Roney. "But before we can claim an actual discovery, other experiments have to replicate it and rule out the possibility this isn't just an unlikely statistical fluctuation."
The BaBar experiment, which collected particle collision data from 1999 to 2008, was designed to explore various mysteries of particle physics, including why the universe contains matter, but no antimatter. The collaboration's data helped confirm a matter-antimatter theory for which two researchers won the 2008 Nobel Prize in Physics.
Researchers continue to apply BaBar data to a variety of questions in particle physics. The data, for instance, has raised more questions about Higgs bosons, which arise from the mechanism thought to give fundamental particles their mass. Higgs bosons are predicted to interact more strongly with heavier particles -- such as the B mesons, D mesons and tau leptons in the BaBar study -- than with lighter ones, but the Higgs posited by the Standard Model can't be involved in this decay.
"If the excess decays shown are confirmed, it will be exciting to figure out what is causing it," said BaBar physics coordinator Abner Soffer, associate professor at Tel Aviv University. Other theories involving new physics are waiting in the wings, but the BaBar results already rule out one important model called the "Two Higgs Doublet Model."
Nun wird noch eine unabhängige Bestätigung benötigt, die aber bald vorliegen kann, wie New Scientist berichtet:
The BaBar team's results are not statistically significant, yet, but they hope a Japanese experiment called Belle will confirm their results soon. If it is confirmed, the standard model may need a revamp, even if the Higgs is discovered to fit neatly into it.
... link (0 Kommentare) ... comment
Mittwoch, 20. Juni 2012
Das Lithium-Problem des Urknalls
klauslange,01:49h
Nun bin ich kein ausgesprochener Gegner des Urknallmodells. Aber es ist mir stets wichtig immer wieder zu zeigen, dass die als zustreffend bezeichneten Modelle des Kosmos auch ihre empirischen Angriffspunkte haben. Beim Urknall ist das u.a. das Lithium-Problem. Im Rahmen des Urknalls hätte viel mehr Lithium entstanden sein müssen, als man durch Beobachtung nachweisen kann. Auf der Suche nach Lithiumvernichtungsmechanismen im All ist man aber nun auf ein Mechanismus gestossen, dass den Lithiumwert im Universum noch weiter erhöhen sollte, was das Lithiumproblem des Urknalls weiter verschärft.
'Welt der Physik' berichtet in einem Artikel:
„Lithium ist eines der wenigen Elemente im Kosmos, deren Häufigkeit entscheidend durch die Nukleosynthese beim Urknall beeinflusst wurde“, erläutern Fabio Iocco von der Universität Stockholm und Miguel Pato von der Technischen Universität München. In den ersten Minuten nach der Entstehung des Universums war die Materie so heiß, dass durch Fusionsprozesse aus Protonen und Neutronen das Wasserstoff-Isotop Deuterium, Helium und in kleinen Spuren auch Lithium entstehen konnten.
Theoretische Modelle der Nukleosynthese sind in hervorragender Übereinstimmung mit der beobachteten Häufigkeit von Wasserstoff und Helium in sehr alten Sternen. Bei dem Element Lithium versagen die Modelle jedoch: Sie sagen dreimal mehr Lithium voraus, als in den Außenschichten alter Sterne tatsächlich beobachtet wird. Astronomen haben eine Vielzahl von Lösungen für dieses Problem vorgeschlagen – doch keiner dieser Ansätze liefert befriedigende Ergebnisse. Denn Prozesse, die den Lithiumanteil verändern, führen oft zu neuen Widersprüchen bei der Häufigkeit anderer Elemente.
Die Arbeit von Iocco und Pato verschärft nun das Lithiumproblem zusätzlich. Denn die beiden Forscher finden keinen Prozess, der Lithium abbaut, sondern im Gegenteil einen, der zusätzliches Lithium herstellt. In der Milchstraße gibt es nach theoretischen Schätzungen mehrere hundert Millionen stellare Schwarzer Löcher – Überreste alter, kollabierter Sterne. Wenn diese Schwarzen Löcher einem nahen Stern Materie entreißen, bildet sich ein heißer, rotierender Materiering um das Schwarze Loch. In diesem Ring ist die Temperatur so hoch, dass durch Kernfusion aus Wasserstoff Lithium entstehen kann, zeigt das Forscherduo. Die Frage, wo dieses Lithium geblieben ist, können auch Iocco und Pato nicht beantworten. Aber sie weisen darauf hin, dass die Produktion von Lithium bei Schwarzen Löchern bei jedem Versuch der Lösung des Lithiumproblems berücksichtigt werden muss.
'Welt der Physik' berichtet in einem Artikel:
„Lithium ist eines der wenigen Elemente im Kosmos, deren Häufigkeit entscheidend durch die Nukleosynthese beim Urknall beeinflusst wurde“, erläutern Fabio Iocco von der Universität Stockholm und Miguel Pato von der Technischen Universität München. In den ersten Minuten nach der Entstehung des Universums war die Materie so heiß, dass durch Fusionsprozesse aus Protonen und Neutronen das Wasserstoff-Isotop Deuterium, Helium und in kleinen Spuren auch Lithium entstehen konnten.
Theoretische Modelle der Nukleosynthese sind in hervorragender Übereinstimmung mit der beobachteten Häufigkeit von Wasserstoff und Helium in sehr alten Sternen. Bei dem Element Lithium versagen die Modelle jedoch: Sie sagen dreimal mehr Lithium voraus, als in den Außenschichten alter Sterne tatsächlich beobachtet wird. Astronomen haben eine Vielzahl von Lösungen für dieses Problem vorgeschlagen – doch keiner dieser Ansätze liefert befriedigende Ergebnisse. Denn Prozesse, die den Lithiumanteil verändern, führen oft zu neuen Widersprüchen bei der Häufigkeit anderer Elemente.
Die Arbeit von Iocco und Pato verschärft nun das Lithiumproblem zusätzlich. Denn die beiden Forscher finden keinen Prozess, der Lithium abbaut, sondern im Gegenteil einen, der zusätzliches Lithium herstellt. In der Milchstraße gibt es nach theoretischen Schätzungen mehrere hundert Millionen stellare Schwarzer Löcher – Überreste alter, kollabierter Sterne. Wenn diese Schwarzen Löcher einem nahen Stern Materie entreißen, bildet sich ein heißer, rotierender Materiering um das Schwarze Loch. In diesem Ring ist die Temperatur so hoch, dass durch Kernfusion aus Wasserstoff Lithium entstehen kann, zeigt das Forscherduo. Die Frage, wo dieses Lithium geblieben ist, können auch Iocco und Pato nicht beantworten. Aber sie weisen darauf hin, dass die Produktion von Lithium bei Schwarzen Löchern bei jedem Versuch der Lösung des Lithiumproblems berücksichtigt werden muss.
... link (0 Kommentare) ... comment
Freitag, 8. Juni 2012
Halbwertzeit des neutrinolosen Doppelbetazerfalls
klauslange,12:39h
Es ist schon interessant: Wenn man englische und deutsche Wissenschaftsmeldungen vergleicht, dann ist es meist so, dass die deutschen Meldungen - gerade in Wissenschaftsjournalen - sehr viel pessimistischer daher kommen als jene auf englisch.
Ein weiteres Beispiel ist der neutrinolose Doppelbetazerfall. In englischen Artikeln freut man sich, dass man eine neue untere Grenze der Halbwertszeit für diesen Zerfall geunden hat und man so der eigentlichen Entdeckung näher kommt (zum Beispiel sciencedail.com Artikel). Auf deutsch wird so gar der neutrinolose Doppelbetazerfall als ganzes sofort infrage gestellt.
So das eigentlich recht nüchterne Portal pro-physik.de setzt in der Artikel-Überschrift so ein Fragezeichen.
Dazu besteht keine Veranlassung. Wie im Artikel selbst erwähnt wird, hat der normale Doppelbetazerfall eine Halbwertszeit von 10^21 Jahre. Nun konnte man die Halbwertszeit des neutrinolosen Doppelbetazerfalls auf ca. 10^25 als Untergrenze festlegen, der eigentliche Zerfall wurde noch nicht gesichtet.
Erklärung aus der Urwort-Theorie
Für mich ist das gar kein Problem, denn wenn es wirklich stimmt, dass das Neutrino aus dem Eta-Teilchen des G4 der Urwort-Theorie hervorgeht (und damit sein eigenes Antiteilchen sein muss), dann würde man eher mit Halbwertszeiten des neutrinolosen Betazerfalls - aufgrund der gegenseitigen Annihilierung der Neutrinos, die ihre eigenen Anti-Teilchen sind - in einem Bereich von 10^29 bis 10^31 Jahren rechnen.
Warum? Neutrino und Antineutrinos annihilieren sich nicht so leicht, wie man in der Mainstream-Wissenschaft annimmt, da sie - ähnlich wie Elektron und Positron als Essenzgemeinschaft - entsprechend 'innerlich strukturiert' sein können. Das ergibt sich schon daraus, dass es eben zu jedem Elektron ein Elektron-Neutrino gibt usw.
Aber auch ohne die Kenntnis aus der Urwort-Theorie, sollte eine Halbwertszeit von ca. 10^27 für den neutrinolosen Doppelbetazerfall keine Überraschung sein.
Ein weiteres Beispiel ist der neutrinolose Doppelbetazerfall. In englischen Artikeln freut man sich, dass man eine neue untere Grenze der Halbwertszeit für diesen Zerfall geunden hat und man so der eigentlichen Entdeckung näher kommt (zum Beispiel sciencedail.com Artikel). Auf deutsch wird so gar der neutrinolose Doppelbetazerfall als ganzes sofort infrage gestellt.
So das eigentlich recht nüchterne Portal pro-physik.de setzt in der Artikel-Überschrift so ein Fragezeichen.
Dazu besteht keine Veranlassung. Wie im Artikel selbst erwähnt wird, hat der normale Doppelbetazerfall eine Halbwertszeit von 10^21 Jahre. Nun konnte man die Halbwertszeit des neutrinolosen Doppelbetazerfalls auf ca. 10^25 als Untergrenze festlegen, der eigentliche Zerfall wurde noch nicht gesichtet.
Erklärung aus der Urwort-Theorie
Für mich ist das gar kein Problem, denn wenn es wirklich stimmt, dass das Neutrino aus dem Eta-Teilchen des G4 der Urwort-Theorie hervorgeht (und damit sein eigenes Antiteilchen sein muss), dann würde man eher mit Halbwertszeiten des neutrinolosen Betazerfalls - aufgrund der gegenseitigen Annihilierung der Neutrinos, die ihre eigenen Anti-Teilchen sind - in einem Bereich von 10^29 bis 10^31 Jahren rechnen.
Warum? Neutrino und Antineutrinos annihilieren sich nicht so leicht, wie man in der Mainstream-Wissenschaft annimmt, da sie - ähnlich wie Elektron und Positron als Essenzgemeinschaft - entsprechend 'innerlich strukturiert' sein können. Das ergibt sich schon daraus, dass es eben zu jedem Elektron ein Elektron-Neutrino gibt usw.
Aber auch ohne die Kenntnis aus der Urwort-Theorie, sollte eine Halbwertszeit von ca. 10^27 für den neutrinolosen Doppelbetazerfall keine Überraschung sein.
... link (0 Kommentare) ... comment
Dienstag, 29. Mai 2012
Kane: STOP- und SBOTTOM- Squarks > 10 TeV/c^2
klauslange,17:14h
Gordon Kane hatte ja auf der Grundlage von Berechnungen im Rahmen der M-Theory eine Higgs-Bosonenmasse von ca. 125 GeV/c^2 vorhergesagt (mein Beitrag dazu hier). Für diese Masse hat das LHC ja auch tatsächliche starke Hinweise auf ein Higgs-Boson gefunden.
Nun habe ich erfahren, dass die selben Berechnungsgrundlagen, mit denen Kane scheinbar Erfolg hatte, zudem noch angeben, dass die Superpartnerteilchen der dritten Generationenquarks größer als 10 TeV/c^2 sind.
Das würde nicht nur einen direkten Nachweis der Supersymmetrie sehr erschweren und für das LHC gar ganz unmöglich machen, sondern es widerspricht meinen Berechnungen auf Grundlage der Urwort-Theorie, denn demgemäß liegen die Massen unter 1 TeV/c^2 (siehe utsusy_v1 (pdf, 290 KB) ).
Wir haben also einen Unterschied von einer Zehnerpotenz im Massenbereich. Das sollte reichen um anhand der Resultate des LHC klar entscheiden zu können, welche Vorhersage und damit welches Modell verworfen werden muss.
Das sehe ich sehr gelassen: Schließlich spielen wir hier nicht 'Wünsch dir was', sondern machen anhand von Modellrechnungen voraussagen, die dann empirisch überprüft werden. Warten wir also einfach die Experimente ab...!
Nun habe ich erfahren, dass die selben Berechnungsgrundlagen, mit denen Kane scheinbar Erfolg hatte, zudem noch angeben, dass die Superpartnerteilchen der dritten Generationenquarks größer als 10 TeV/c^2 sind.
Das würde nicht nur einen direkten Nachweis der Supersymmetrie sehr erschweren und für das LHC gar ganz unmöglich machen, sondern es widerspricht meinen Berechnungen auf Grundlage der Urwort-Theorie, denn demgemäß liegen die Massen unter 1 TeV/c^2 (siehe utsusy_v1 (pdf, 290 KB) ).
Wir haben also einen Unterschied von einer Zehnerpotenz im Massenbereich. Das sollte reichen um anhand der Resultate des LHC klar entscheiden zu können, welche Vorhersage und damit welches Modell verworfen werden muss.
Das sehe ich sehr gelassen: Schließlich spielen wir hier nicht 'Wünsch dir was', sondern machen anhand von Modellrechnungen voraussagen, die dann empirisch überprüft werden. Warten wir also einfach die Experimente ab...!
... link (0 Kommentare) ... comment
Montag, 7. Mai 2012
Grundsätzliches zur Existenz Dunkler Materie und SUSY
klauslange,18:45h
Da wohl mit einigen vorgestellten Meldungen, die die Existenz der Dunklen Materie in Frage stellen, der Eindruck entstanden ist, ich könnte selbst meinen, dass Dunkle Materie generell nicht existiert, möchte ich nur kurz klarstellen, dass dies nicht der Fall ist.
Zunächst finde ich es stets spannend, wenn in der Wissenschaft ein offener Schlagabtausch über grundsätzliche Fragen von weitreichender Bedeutung stattfindet. Am Beispiel der Dunklen Materie wird dies sehr deutlich. Genau so stelle ich mir Wissenschaft vor und ich finde es traurig, dass man dies noch nicht im Bereich der Biologie gelernt hat. Da scheint es ja nur um Detailfragen zu gehen, was aber nicht stimmt.
Doch ich möchte nicht vom Thema abschweifen: Das Konzept der Dunklen Materie finde ich schon sehr gut begründet. Nur - und das scheinen mir jüngste Meldungen zu bestätigen - ist diese Dunkle Materie wohl auch noch mit ganz anderen Eigenschaften unterwegs, als man sich das so vorstellt. Ferner denke ich, dass es nicht nur eine Art von nicht-baryonischer Dunkler Materie zu geben braucht, was natürlich die Situation noch weiter verschärfen würde.
Letztlich denke ich, dass man allein mit indirektem Schließen von Bewegungen und Verteilungen von Massen das Wesen Dunkler Materie nicht aufklären wird und auch ihre Existenz nicht wird bestätigen können. Ich setze da eher auf Annihilationseregnisse Dunkler Materie, wie man sie mit Weltraumteleskopen im radiometrischen Bereich detektieren kann.
Gute Kandidaten zumindest von einer Form der Dunklen Materie dürfte die Supersymmetrie (siehe auch meine Arbeit aus dem Jahre 2008 Supersymmetrie als mathematisches Design-Signal) liefern, wie ich sie ja auch im Rahmen der Urwort-Theorie verortet habe. Neben meinen Arbeiten zu den Würfelnetzen (siehe hier, wobei die Urwort-Theorie weit natürlicher die SUSY mit der Heim-Theorie verbindet. Auch die Würfelnetze (cubenetstructure (pdf, 24 KB) ) kommen zum Einsatz, nur beim G4 mit vierdimensionalen Würfeln!), hat gerade auch die letzte Abhandlung (siehe utsusy_v1 (pdf, 290 KB) ) mich in der Annahme der Existenz Dunkler Materie sehr bestärkt.
Zunächst finde ich es stets spannend, wenn in der Wissenschaft ein offener Schlagabtausch über grundsätzliche Fragen von weitreichender Bedeutung stattfindet. Am Beispiel der Dunklen Materie wird dies sehr deutlich. Genau so stelle ich mir Wissenschaft vor und ich finde es traurig, dass man dies noch nicht im Bereich der Biologie gelernt hat. Da scheint es ja nur um Detailfragen zu gehen, was aber nicht stimmt.
Doch ich möchte nicht vom Thema abschweifen: Das Konzept der Dunklen Materie finde ich schon sehr gut begründet. Nur - und das scheinen mir jüngste Meldungen zu bestätigen - ist diese Dunkle Materie wohl auch noch mit ganz anderen Eigenschaften unterwegs, als man sich das so vorstellt. Ferner denke ich, dass es nicht nur eine Art von nicht-baryonischer Dunkler Materie zu geben braucht, was natürlich die Situation noch weiter verschärfen würde.
Letztlich denke ich, dass man allein mit indirektem Schließen von Bewegungen und Verteilungen von Massen das Wesen Dunkler Materie nicht aufklären wird und auch ihre Existenz nicht wird bestätigen können. Ich setze da eher auf Annihilationseregnisse Dunkler Materie, wie man sie mit Weltraumteleskopen im radiometrischen Bereich detektieren kann.
Gute Kandidaten zumindest von einer Form der Dunklen Materie dürfte die Supersymmetrie (siehe auch meine Arbeit aus dem Jahre 2008 Supersymmetrie als mathematisches Design-Signal) liefern, wie ich sie ja auch im Rahmen der Urwort-Theorie verortet habe. Neben meinen Arbeiten zu den Würfelnetzen (siehe hier, wobei die Urwort-Theorie weit natürlicher die SUSY mit der Heim-Theorie verbindet. Auch die Würfelnetze (cubenetstructure (pdf, 24 KB) ) kommen zum Einsatz, nur beim G4 mit vierdimensionalen Würfeln!), hat gerade auch die letzte Abhandlung (siehe utsusy_v1 (pdf, 290 KB) ) mich in der Annahme der Existenz Dunkler Materie sehr bestärkt.
... link (0 Kommentare) ... comment
Montag, 30. April 2012
Keine Dunkle Materie in der Milchstrasse
klauslange,01:52h
Nach dem schon in der Nachbarschaft des Sonnensystems Dunkle Materie keinen Platz hat, sind nun auch viel größere Strukturen in der Milchstrasse betroffen, wie welt der physik berichtet: hier.
„Unsere Analyse hat uns ein neues Bild unserer kosmischen Nachbarschaft geliefert“, sagt Marcel Pawlowski, einer der Forscher. Gemeinsam mit seinen Kollegen Jan Pflamm-Altenburg und Pavel Kroupa hatte er alle verfügbaren Aufnahmen des Himmels – von frühen fotografischen Platten bis hin zu den modernen, von einem Roboterteleskop aufgenommenen Bildern des „Sloan Digital Sky Survey“ ausgewertet. Dabei untersuchten die drei Wissenschaftler erstmals auch die Verteilung der Kugelsternhaufen im sogenannten Halo der Milchstraße sowie die Orientierung von Sternströmen.
„Wir waren erstaunt darüber, dass die räumlichen Verteilungen dieser unterschiedlichen Arten von Objekten in sehr guter Übereinstimmung miteinander sind“, so Kroupa. Zwerggalaxien, Kugelsternhaufen und Sternströme zeigen eine starke Konzentration auf einer Ebene, die senkrecht auf der Scheibenebene der spiralförmigen Milchstraße steht – und diese „polare“ Struktur reicht mit einer Ausdehnung von einer Million Lichtjahren weit über die 100.000 Lichtjahre durchmessende galaktische Scheibe hinaus. Von besonderer Bedeutung ist, so betonen die Astrophysiker, dass sich auch die Sternströme in dieser Ebene befinden: „Das zeigt, dass diese Objekte sich nicht zufällig gerade jetzt dort ansammeln, sondern dass sie sich darin bewegen“, so Pawlowski, „die Struktur ist also stabil.“
Die Existenz einer solchen ausgedehnten, polaren Struktur ist allerdings nicht mit dem Standardmodell der Kosmologie in Einklang zu bringen, in dem 80 Prozent der Materie im Universum „dunkel“ ist und aus bislang unbekannten Elementarteilchen besteht. Das Modell sagt voraus, dass große Galaxien wie die Milchstraße gleichmäßig von einer großen Zahl von Zwergsystemen umgeben sind. „Es ist völlig unmöglich, dass diese kleinen Galaxien alle in einer Ebene enden“, sagt Kroupa. Und sein Kollege Pflamm-Altenburg ergänzt: „Die Satelliten-Galaxien und Sternhaufen müssen zeitgleich bei einem einzigen Ereignis entstanden sein, beim Zusammenstoß zweier Galaxien.“
Wenn jedoch all diese Objekte ihren Ursprung in der Kollision der jungen Milchstraße mit einer zweiten Galaxie haben, dann folgt daraus, dass die Milchstraße keinerlei Begleiter besitzt, wie sie das Standardmodell mit seinem dominierenden Anteil an Dunkler Materie vorhersagt. Pawlowski, Pflamm-Altenburg und Kroupa sehen darin „ein katastrophales Versagen des Standardmodells der Kosmologie“. Die Beobachtungen stünden im klaren Widerspruch zu einer dominierenden Rolle Dunkler Materie im Universum.
„Unsere Analyse hat uns ein neues Bild unserer kosmischen Nachbarschaft geliefert“, sagt Marcel Pawlowski, einer der Forscher. Gemeinsam mit seinen Kollegen Jan Pflamm-Altenburg und Pavel Kroupa hatte er alle verfügbaren Aufnahmen des Himmels – von frühen fotografischen Platten bis hin zu den modernen, von einem Roboterteleskop aufgenommenen Bildern des „Sloan Digital Sky Survey“ ausgewertet. Dabei untersuchten die drei Wissenschaftler erstmals auch die Verteilung der Kugelsternhaufen im sogenannten Halo der Milchstraße sowie die Orientierung von Sternströmen.
„Wir waren erstaunt darüber, dass die räumlichen Verteilungen dieser unterschiedlichen Arten von Objekten in sehr guter Übereinstimmung miteinander sind“, so Kroupa. Zwerggalaxien, Kugelsternhaufen und Sternströme zeigen eine starke Konzentration auf einer Ebene, die senkrecht auf der Scheibenebene der spiralförmigen Milchstraße steht – und diese „polare“ Struktur reicht mit einer Ausdehnung von einer Million Lichtjahren weit über die 100.000 Lichtjahre durchmessende galaktische Scheibe hinaus. Von besonderer Bedeutung ist, so betonen die Astrophysiker, dass sich auch die Sternströme in dieser Ebene befinden: „Das zeigt, dass diese Objekte sich nicht zufällig gerade jetzt dort ansammeln, sondern dass sie sich darin bewegen“, so Pawlowski, „die Struktur ist also stabil.“
Die Existenz einer solchen ausgedehnten, polaren Struktur ist allerdings nicht mit dem Standardmodell der Kosmologie in Einklang zu bringen, in dem 80 Prozent der Materie im Universum „dunkel“ ist und aus bislang unbekannten Elementarteilchen besteht. Das Modell sagt voraus, dass große Galaxien wie die Milchstraße gleichmäßig von einer großen Zahl von Zwergsystemen umgeben sind. „Es ist völlig unmöglich, dass diese kleinen Galaxien alle in einer Ebene enden“, sagt Kroupa. Und sein Kollege Pflamm-Altenburg ergänzt: „Die Satelliten-Galaxien und Sternhaufen müssen zeitgleich bei einem einzigen Ereignis entstanden sein, beim Zusammenstoß zweier Galaxien.“
Wenn jedoch all diese Objekte ihren Ursprung in der Kollision der jungen Milchstraße mit einer zweiten Galaxie haben, dann folgt daraus, dass die Milchstraße keinerlei Begleiter besitzt, wie sie das Standardmodell mit seinem dominierenden Anteil an Dunkler Materie vorhersagt. Pawlowski, Pflamm-Altenburg und Kroupa sehen darin „ein katastrophales Versagen des Standardmodells der Kosmologie“. Die Beobachtungen stünden im klaren Widerspruch zu einer dominierenden Rolle Dunkler Materie im Universum.
... link (0 Kommentare) ... comment
Donnerstag, 19. April 2012
Keine Dunkle Materie in Sonnen-'Nähe'
klauslange,11:29h
Mit nie gekannter Genauigkeit wurden in einem Umkreis von 13000 Lichtjahren um die Sonne die Massen vermessen. Dann wurden die Bewegungen der Massen (Stern, Gas usw.) bestimmt: Diese Bewegungen stimmen sehr gut mit den sichtbaren Massen überein. Es braucht keine Dunkle Materie in diesem Raumbereich angenommen werden. Mehr noch: Zumindest in diesem Raumbereich hat Dunkle Materie keinen Platz, ganz im Widerspruch zu den gängigen Theorien. Diese sagen voraus, dass man in einem solchen Raumbereich eine Beeinflussung durch Dunkle Materie messen können muss. Astronews.com berichtet darüber hier:
Mit dem MPG/ESO-2,2-Meter-Teleskop der europäischen Südsternwarte ESO in La Silla und anderen Teleskopen hat ein Astronomenteam die Bewegung von über 400 Sternen bis in eine Entfernung von rund 13.000 Lichtjahren von der Sonne sehr genau kartiert und daraus die Masse des Materials in der Umgebung der Sonne berechnet. Diese Masse nämlich beeinflusst das Bewegungsverhalten der Sterne. Die Forscher berücksichtigten dabei ein viermal größeres Volumen als bei früheren Untersuchungen.
"Die Menge an Masse, die wir errechnet haben, stimmt sehr gut mit dem überein was wir in der Region rund um die Sonne sehen - Sterne, Gas und Staub", erläutert Teamleiter Christian Moni Bidin vom Departamento de Astronomía der Universidad de Concepción in Chile. "Das lässt aber keinen Raum für anderes Material, also Dunkle Materie, die wir dort erwartet hatten. Unsere Berechnungen zeigen, dass sie eigentlich eindeutig messbar hätte sein müssen. Aber sie ist einfach nicht da gewesen."
Nach den Standardmodellen der Astronomen über die Entstehung und Entwicklung von Galaxien sollte die Milchstraße eigentlich in einen Halo aus Dunkler Materie eingebettet sein. Welche Form dieser Halo genau hat, wissen sie nicht, doch sprach bislang alles dafür, dass sich auch in der Umgebung der Sonne signifikante Mengen von Dunkler Materie finden lassen müssten. Nur ein Dunkelmaterie-Halo mit einer sehr ungewöhnlichen - beispielsweise extrem langgezogenen - Form wäre mit den Ergebnissen der jetzt vorgestellten Studie vereinbar.
Die Dunkelmaterie-Modelle sagen für die galaktische Region in der sich unsere Sonne befindet, in einem Volumen von der Größe der Erde etwa 0,4 bis ein Kilogramm Dunkelmaterie voraus. In der neuen Studie wurde praktisch nichts gefunden. Das Ergebnis bedeutet auch, dass Versuche, auf der Erde äußerst seltene Wechselwirkungen zwischen "normaler" Materie und Dunkelmaterie zu beobachten, kaum Aussicht auf Erfolg haben dürften.
"Trotz der neuen Ergebnisse rotiert die Milchstraße aber deutlich schneller als sich mit der vorhandenen sichtbaren Materie erklären lässt", so Bidin. "Wenn sich die Dunkle Materie also nicht dort befindet, wo wir sie erwarten, brauchen wir eine neue Lösung für das Problem der fehlenden Masse. Unsere Ergebnisse widersprechen klar dem gegenwärtig akzeptierten Modell. Die mysteriöse Dunkle Materie ist noch ein wenig mysteriöser geworden."
Mit dem MPG/ESO-2,2-Meter-Teleskop der europäischen Südsternwarte ESO in La Silla und anderen Teleskopen hat ein Astronomenteam die Bewegung von über 400 Sternen bis in eine Entfernung von rund 13.000 Lichtjahren von der Sonne sehr genau kartiert und daraus die Masse des Materials in der Umgebung der Sonne berechnet. Diese Masse nämlich beeinflusst das Bewegungsverhalten der Sterne. Die Forscher berücksichtigten dabei ein viermal größeres Volumen als bei früheren Untersuchungen.
"Die Menge an Masse, die wir errechnet haben, stimmt sehr gut mit dem überein was wir in der Region rund um die Sonne sehen - Sterne, Gas und Staub", erläutert Teamleiter Christian Moni Bidin vom Departamento de Astronomía der Universidad de Concepción in Chile. "Das lässt aber keinen Raum für anderes Material, also Dunkle Materie, die wir dort erwartet hatten. Unsere Berechnungen zeigen, dass sie eigentlich eindeutig messbar hätte sein müssen. Aber sie ist einfach nicht da gewesen."
Nach den Standardmodellen der Astronomen über die Entstehung und Entwicklung von Galaxien sollte die Milchstraße eigentlich in einen Halo aus Dunkler Materie eingebettet sein. Welche Form dieser Halo genau hat, wissen sie nicht, doch sprach bislang alles dafür, dass sich auch in der Umgebung der Sonne signifikante Mengen von Dunkler Materie finden lassen müssten. Nur ein Dunkelmaterie-Halo mit einer sehr ungewöhnlichen - beispielsweise extrem langgezogenen - Form wäre mit den Ergebnissen der jetzt vorgestellten Studie vereinbar.
Die Dunkelmaterie-Modelle sagen für die galaktische Region in der sich unsere Sonne befindet, in einem Volumen von der Größe der Erde etwa 0,4 bis ein Kilogramm Dunkelmaterie voraus. In der neuen Studie wurde praktisch nichts gefunden. Das Ergebnis bedeutet auch, dass Versuche, auf der Erde äußerst seltene Wechselwirkungen zwischen "normaler" Materie und Dunkelmaterie zu beobachten, kaum Aussicht auf Erfolg haben dürften.
"Trotz der neuen Ergebnisse rotiert die Milchstraße aber deutlich schneller als sich mit der vorhandenen sichtbaren Materie erklären lässt", so Bidin. "Wenn sich die Dunkle Materie also nicht dort befindet, wo wir sie erwarten, brauchen wir eine neue Lösung für das Problem der fehlenden Masse. Unsere Ergebnisse widersprechen klar dem gegenwärtig akzeptierten Modell. Die mysteriöse Dunkle Materie ist noch ein wenig mysteriöser geworden."
... link (0 Kommentare) ... comment
Montag, 16. April 2012
Hinweis auf Majorana - Fermionen
klauslange,17:54h
Wer meine Blogeinträge aufmerksam liest, der wird wissen, dass ich die Majoraner-Eigenschaft als eine vorhersage der Urwort-Theorie ansehe. Nun gibt es erste Hinweise, dass Fermionen in der Natur tatsächlich eine solche Eigneschaft besitzen können, wie pro-physik.de berichtet: hier.
Darin wird erläutert:
Die Dirac-Gleichung beschreibt ein geladenes Fermion durch ein Feld ψ, das komplexe Werte annimmt und deshalb vom komplex konjugierten Feld ψ* verschieden ist, durch das das entsprechende Antiteilchen beschrieben wird. Ettore Majorana (1906-1938), der nach Enrico Fermis Zeugnis ein Genie ersten Ranges war, fand heraus, dass man die Dirac-Gleichung in eine Form bringen kann, so dass das Feld ψ reell ist und folglich mit dem Antiteilchenfeld ψ* übereinstimmt. Teilchen und Antiteilchen sind dann identisch. Ob das auch für Neutrinos gilt, sollen u. a. Experimente zum neutrinolosen Doppel-Betazerfall klären, bei dem sich die beiden entstehenden Neutrinos sogleich wieder vernichten.
Beim Wettrennen um den Nachweis von Majorana-Fermionen haben die Teilchenphysiker in letzter Zeit Konkurrenz von den Festkörperphysikern bekommen. Kondensierte Materie besteht zwar ausschließlich aus Elektronen, Protonen und Neutronen, die nicht ihre eigenen Antiteilchen sind. Doch in kondensierter Materie können Anregungen auftreten, deren Quasiteilchen exotische Eigenschaften besitzen. So könnten sich Elektronen in einem unkonventionellen Supraleiter mit Spintriplett-Paarung wie Majorana-Fermionen verhalten: Zwei Elektronen mit gleicher Energie und gleicher Spinrichtung „annihilieren“, indem sie ein Cooper-Paar bilden. Da die Spintriplett-Paarung aber sehr fragil ist, steht der Nachweis, dass dabei tatsächlich Majorana-Fermionen auftreten, noch aus.
In einem herkömmlichen Supraleiter paaren sich Elektronen mit entgegengesetzt gerichtetem Spin, die sich somit voneinander unterscheiden und deshalb keine Majorana-Fermionen sein können. Tritt indes eine starke Spin-Bahn-Kopplung zwischen dem Spin der Elektronen und ihrer Bewegung im Kristall auf, dann wird die Spinerhaltung verletzt und es ergeben sich neue Möglichkeiten. So entsteht etwa ein topologischer Isolator mit einer ungewöhnlichen Bandstruktur, der in seinem Inneren ein Nichtleiter ist, während er an seiner Oberfläche metallisch leitet.
Bringt man einen topologischen Isolator in Kontakt mit einem konventionellen Supraleiter, so wird aus dem Isolator ein topologischer Supraleiter, der sowohl eine ungewöhnliche Bandstruktur als auch die für Supraleiter charakteristische Bandlücke aufweist. Frühere Berechnungen hatten gezeigt, dass in der Mitte der Bandlücke Anregungen mit einer Energie E=0 auftreten, die durch Paarung von Elektronen und Löchern entstehen und somit ungeladen sind. Die entsprechenden Quasiteilchen sitzen auf der metallischen Oberfläche des Supraleiters und sollten sich wie Majorana-Fermionen verhalten. Leo Kouwenhoven und seine Kollegen von an der TU Delft haben diese Vorhersage jetzt experimentell überprüft.
Die Forscher haben einen InSb-Halbleiternanodraht auf eine Unterlage mit verschiedenen elektrischen Kontakten gebracht. An einem Ende war der Draht an eine Goldelektrode angeschlossen, am anderen Ende seitlich mit einem Supraleiter verbunden. Einer der elektrischen Kontakten erzeugte durch eine Gate-Spannung eine Tunnelbarriere im Draht, die ihn in einen normal- und einen supraleitenden Abschnitt teilte. Kouwenhoven und seine Mitarbeiter maßen den differentiellen Tunnelstrom dI/dV im Draht in Abhängigkeit von der angelegten Spannung und dem Magnetfeld, dem der Draht ausgesetzt wurde. In der Meßkurve fanden sie mehrere Maxima, die sich bekannten Anregungen zuordnen ließen. Doch ein Maximum bei V=0 war ungewöhnlich und verhielt sich anders als alle bekannten Anregungen in Supraleitern. Es hing, im Gegensatz zu den anderen Maxima, weder von der Gate-Spannung noch von der Stärke des Magnetfeldes ab, wenn dieses parallel zum Draht gerichtet war.
Das beobachtete Maximum entsprach einer Anregung aus ungeladenen Teilchen mit einer Energie E=0, was im Einklang damit ist, dass es sich dabei um Majorana-Fermionen handelte. Die Forscher überprüften dies, indem sie das Experiment abänderten und z. B. den an den Draht angefügten Supraleiter durch einen Normalleiter ersetzten oder die Richtung des Magnetfeldes änderten. Der Theorie zufolge konnten dann keine Majorana-Fermionen auftreten. Und tatsächlich beobachteten die Forscher in diesen Fällen, dass der ominöse „Peak“ in der Tunnelstromkurve verschwand.
Noch sind nicht alle „Majorana-Forscher“ von diesem vermeintlichen Nachweis überzeugt. Deshalb wollen Kouwenhoven und seine Mitarbeiter zeigen, dass die von ihnen beobachteten Anregungen dieselben ungewöhnlichen topologischen Eigenschaften haben wie Majorana-Fermionen. Tauschen zwei dieser Teilchen ihre Plätze, so behalten sie das in „Erinnerung“, indem ihre Wellenfunktion eine topologische Phase gewinnt. Dieses Verhalten macht die Majorana-Fermionen interessant für das Quantencomputing. Ein direkter Nachweis dieser Phase würde wohl auch die Skeptiker überzeugen.
Darin wird erläutert:
Die Dirac-Gleichung beschreibt ein geladenes Fermion durch ein Feld ψ, das komplexe Werte annimmt und deshalb vom komplex konjugierten Feld ψ* verschieden ist, durch das das entsprechende Antiteilchen beschrieben wird. Ettore Majorana (1906-1938), der nach Enrico Fermis Zeugnis ein Genie ersten Ranges war, fand heraus, dass man die Dirac-Gleichung in eine Form bringen kann, so dass das Feld ψ reell ist und folglich mit dem Antiteilchenfeld ψ* übereinstimmt. Teilchen und Antiteilchen sind dann identisch. Ob das auch für Neutrinos gilt, sollen u. a. Experimente zum neutrinolosen Doppel-Betazerfall klären, bei dem sich die beiden entstehenden Neutrinos sogleich wieder vernichten.
Beim Wettrennen um den Nachweis von Majorana-Fermionen haben die Teilchenphysiker in letzter Zeit Konkurrenz von den Festkörperphysikern bekommen. Kondensierte Materie besteht zwar ausschließlich aus Elektronen, Protonen und Neutronen, die nicht ihre eigenen Antiteilchen sind. Doch in kondensierter Materie können Anregungen auftreten, deren Quasiteilchen exotische Eigenschaften besitzen. So könnten sich Elektronen in einem unkonventionellen Supraleiter mit Spintriplett-Paarung wie Majorana-Fermionen verhalten: Zwei Elektronen mit gleicher Energie und gleicher Spinrichtung „annihilieren“, indem sie ein Cooper-Paar bilden. Da die Spintriplett-Paarung aber sehr fragil ist, steht der Nachweis, dass dabei tatsächlich Majorana-Fermionen auftreten, noch aus.
In einem herkömmlichen Supraleiter paaren sich Elektronen mit entgegengesetzt gerichtetem Spin, die sich somit voneinander unterscheiden und deshalb keine Majorana-Fermionen sein können. Tritt indes eine starke Spin-Bahn-Kopplung zwischen dem Spin der Elektronen und ihrer Bewegung im Kristall auf, dann wird die Spinerhaltung verletzt und es ergeben sich neue Möglichkeiten. So entsteht etwa ein topologischer Isolator mit einer ungewöhnlichen Bandstruktur, der in seinem Inneren ein Nichtleiter ist, während er an seiner Oberfläche metallisch leitet.
Bringt man einen topologischen Isolator in Kontakt mit einem konventionellen Supraleiter, so wird aus dem Isolator ein topologischer Supraleiter, der sowohl eine ungewöhnliche Bandstruktur als auch die für Supraleiter charakteristische Bandlücke aufweist. Frühere Berechnungen hatten gezeigt, dass in der Mitte der Bandlücke Anregungen mit einer Energie E=0 auftreten, die durch Paarung von Elektronen und Löchern entstehen und somit ungeladen sind. Die entsprechenden Quasiteilchen sitzen auf der metallischen Oberfläche des Supraleiters und sollten sich wie Majorana-Fermionen verhalten. Leo Kouwenhoven und seine Kollegen von an der TU Delft haben diese Vorhersage jetzt experimentell überprüft.
Die Forscher haben einen InSb-Halbleiternanodraht auf eine Unterlage mit verschiedenen elektrischen Kontakten gebracht. An einem Ende war der Draht an eine Goldelektrode angeschlossen, am anderen Ende seitlich mit einem Supraleiter verbunden. Einer der elektrischen Kontakten erzeugte durch eine Gate-Spannung eine Tunnelbarriere im Draht, die ihn in einen normal- und einen supraleitenden Abschnitt teilte. Kouwenhoven und seine Mitarbeiter maßen den differentiellen Tunnelstrom dI/dV im Draht in Abhängigkeit von der angelegten Spannung und dem Magnetfeld, dem der Draht ausgesetzt wurde. In der Meßkurve fanden sie mehrere Maxima, die sich bekannten Anregungen zuordnen ließen. Doch ein Maximum bei V=0 war ungewöhnlich und verhielt sich anders als alle bekannten Anregungen in Supraleitern. Es hing, im Gegensatz zu den anderen Maxima, weder von der Gate-Spannung noch von der Stärke des Magnetfeldes ab, wenn dieses parallel zum Draht gerichtet war.
Das beobachtete Maximum entsprach einer Anregung aus ungeladenen Teilchen mit einer Energie E=0, was im Einklang damit ist, dass es sich dabei um Majorana-Fermionen handelte. Die Forscher überprüften dies, indem sie das Experiment abänderten und z. B. den an den Draht angefügten Supraleiter durch einen Normalleiter ersetzten oder die Richtung des Magnetfeldes änderten. Der Theorie zufolge konnten dann keine Majorana-Fermionen auftreten. Und tatsächlich beobachteten die Forscher in diesen Fällen, dass der ominöse „Peak“ in der Tunnelstromkurve verschwand.
Noch sind nicht alle „Majorana-Forscher“ von diesem vermeintlichen Nachweis überzeugt. Deshalb wollen Kouwenhoven und seine Mitarbeiter zeigen, dass die von ihnen beobachteten Anregungen dieselben ungewöhnlichen topologischen Eigenschaften haben wie Majorana-Fermionen. Tauschen zwei dieser Teilchen ihre Plätze, so behalten sie das in „Erinnerung“, indem ihre Wellenfunktion eine topologische Phase gewinnt. Dieses Verhalten macht die Majorana-Fermionen interessant für das Quantencomputing. Ein direkter Nachweis dieser Phase würde wohl auch die Skeptiker überzeugen.
... link (0 Kommentare) ... comment
... nächste Seite