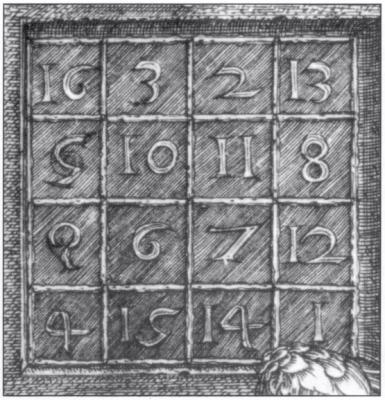Mittwoch, 26. Juni 2013
Atheistischer Philosoph: Neodarwinismus falsch !?
klauslange,15:11h
In den USA macht ein bekannter und anerkannter atheistischer Philosoph Schlagzeilen, da er begründet, warum der Neodarwinismus sehr wahrscheinlich falsch ist. Stattdessen gesteht er der Natur einer Finalität zu, ohne aber damit die Existenz eines Designers zu behaupten:
Thomas Nagel, Mind and Cosmos. Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature is Almost Certainly False (Oxford University Press)
Natürlich bringt er damit eine Welle der Empörung gegen sich auf, trotz seiner Abgrenzung zum Intelligent Design, doch seine Analyse zum Neodarwinismus ist für diesen nun einmal vernichtend und nun bekommt er die ganze Wut der heutigen Darwin-Jüngerschaft zu spüren.
Wort und Wissen berichtet darüber hier.
Vor kurzem habe ich einen sehr interessanten Film gesehen:
Expelled!
Ein Film von Ben Stein.
Darin wird gezeigt, wie einst angesehene Naturwissenschaftler ihre Anstellungen verloren, weil sie aufgrund ihrer Forschung erkannten, dass die Entwicklung des Lebens nicht durch ungerichtete Zufallsmutationen entstanden sein kann.
Diese darin gezeigte diktatorische Existenzvernichtung solcher Wissenschaftler erinnert mich an das Geheul gegen diesen Philosophen...
Thomas Nagel, Mind and Cosmos. Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature is Almost Certainly False (Oxford University Press)
Natürlich bringt er damit eine Welle der Empörung gegen sich auf, trotz seiner Abgrenzung zum Intelligent Design, doch seine Analyse zum Neodarwinismus ist für diesen nun einmal vernichtend und nun bekommt er die ganze Wut der heutigen Darwin-Jüngerschaft zu spüren.
Wort und Wissen berichtet darüber hier.
Vor kurzem habe ich einen sehr interessanten Film gesehen:
Expelled!
Ein Film von Ben Stein.
Darin wird gezeigt, wie einst angesehene Naturwissenschaftler ihre Anstellungen verloren, weil sie aufgrund ihrer Forschung erkannten, dass die Entwicklung des Lebens nicht durch ungerichtete Zufallsmutationen entstanden sein kann.
Diese darin gezeigte diktatorische Existenzvernichtung solcher Wissenschaftler erinnert mich an das Geheul gegen diesen Philosophen...
... link (0 Kommentare) ... comment
Mittwoch, 17. April 2013
Homo floresiensis als verkleinerte Ausgabe des Homo erectus
klauslange,15:44h
Als auf der Insel Floris Überreste kleiner Menschen gefunden wurde, war die Diskussion groß.
Evolutionisten wollen nicht wahrhaben, dass solche kleine Menschen mit vollen kognitiven Fähigkeiten existieren können, denn sie stufen kleine Primaten-Gehirne gern als evolutionäre Vorstufe bei einer vermeintlichen Menschheitsentwicklung ein. Wäre aber diese Inselbewohner vor ca. 12000 Jahren wirklich echte Mitglieder der Gattung 'Homo', dann wären solche Einordnungen gefährdet.
Doch im Streit um die einstigen Floris-Bewohner hat sich nun wieder die Waagschale ganz eindeutig zu Gunsten der Einordnung als Homo floresiensis geneigt, wie scinexx.de berichtet:
Zunächst hatten beispielsweise viele Forscher angenommen, dass die winzigen Knochen und speziell der kleine Schädel von kranken beziehungsweise behinderten Angehörigen der Frühmenschenart Homo erectus oder sogar der frühen Homo sapiens stammen. Allerdings konnte diese These später zum größten Teil entkräftet werden. So scheint H. floresiensis beispielsweise ein gewiefter Werkzeugmacher gewesen zu sein und ein sehr aktives Leben geführt zu haben – beides Dinge, die mit einer derart starken Behinderung unvereinbar sind, wie sie durch eine solche Mikrozephalie verursacht werden würde...
Das dritte Szenario ist trotz seiner Schwächen bisher am weitesten akzeptiert: Homo floresiensis war demnach eine eigene Menschenart, die sich aus dem damals bereits auf Java und anderen benachbarten Inseln heimischen Homo erectus entwickelte. Die Anhänger dieser These gehen davon aus, dass eine lange Zeit der Isolation auf der kleinen Insel Flores zu einer klassischen Inselverzwergung geführt hat, wie man sie auch von vielen Tieren wie Waldelefanten und Mini-Rentieren kennt.
Einige Kritiker können sich damit jedoch nicht anfreunden: Sie halten es für ausgeschlossen, dass der kräftige, robuste Homo erectus mit seinem relativ großen Gehirn von etwa 1.000 Kubikzentimetern Volumen den winzigen Homo floresiensis hervorgebracht hat, dessen Gehirnvolumen auf unter 400 Kubikzentimeter geschätzt wird...
Um sich diesem Problem nun erneut zu nähern, haben Daisuke Kubo von der Universität Tokio und seine Kollegen zunächst den Schädel von LB1 neu vermessen, dem Skelett eines vermutlich weiblcihen Vertreters des Homo floresiensis. Dazu fertigten sie mit Hilfe extrem detailreicher CT-Aufnahmen dreidimensionale Modelle der Innenseite des Schädels an und korrigierten sie anschließend – etwa indem sie fehlende Stellen ergänzten, Deformierungen ausglichen und am Knochen haftendes Gestein abzogen, das bei der Ausgrabung nicht entfernt worden war. Heraus kam ein Gehirn, dessen Volumen 426 Kubikzentimeter betrug – und das somit deutlich größer war als die bisher geschätzten knapp 400 Kubikzentimeter.
Als nächstes berechnete das Team, wie groß ein Homo-erectus-Gehirn gewesen wäre, wenn dessen Körper nur die Größe des Hobbits gehabt hätte. Dazu ermittelten sie das Verhältnis von Gehirnvolumen zu Körpergröße bei Homo erectus-Funden und zum Vergleich auch bei 20 verschiedenen Homo-sapiens-Vertretern, sowie bei Homo habilis.
Das Ergebnis: Geht man von den Werten für eine Homo-erectus-Frau aus, war das Gehirn von H. floresiensis nur um 10 bis 29 Prozent kleiner, als es bei einer rein proportionalen Verkleinerung hätte sein dürfen. Diese Schrumpfung aber liegt noch durchaus innerhalb der Spannbreite, die für Inselverzwergungen typisch sind. Einen solchen Effekt kennt man auch von Tieren. So war beispielsweise das Gehirnvolumen des mittlerweile ausgestorbenen Madagassischen Zwergflusspferdes ebenfalls um etwa 30 Prozent geringer als es seine Körpergröße erwarten ließ. Und auch die früher auf Mallorca lebende Bergziege hatte ein um 50 Prozent kleineres Gehirn als es hätte sein sollen.
Evolutionisten wollen nicht wahrhaben, dass solche kleine Menschen mit vollen kognitiven Fähigkeiten existieren können, denn sie stufen kleine Primaten-Gehirne gern als evolutionäre Vorstufe bei einer vermeintlichen Menschheitsentwicklung ein. Wäre aber diese Inselbewohner vor ca. 12000 Jahren wirklich echte Mitglieder der Gattung 'Homo', dann wären solche Einordnungen gefährdet.
Doch im Streit um die einstigen Floris-Bewohner hat sich nun wieder die Waagschale ganz eindeutig zu Gunsten der Einordnung als Homo floresiensis geneigt, wie scinexx.de berichtet:
Zunächst hatten beispielsweise viele Forscher angenommen, dass die winzigen Knochen und speziell der kleine Schädel von kranken beziehungsweise behinderten Angehörigen der Frühmenschenart Homo erectus oder sogar der frühen Homo sapiens stammen. Allerdings konnte diese These später zum größten Teil entkräftet werden. So scheint H. floresiensis beispielsweise ein gewiefter Werkzeugmacher gewesen zu sein und ein sehr aktives Leben geführt zu haben – beides Dinge, die mit einer derart starken Behinderung unvereinbar sind, wie sie durch eine solche Mikrozephalie verursacht werden würde...
Das dritte Szenario ist trotz seiner Schwächen bisher am weitesten akzeptiert: Homo floresiensis war demnach eine eigene Menschenart, die sich aus dem damals bereits auf Java und anderen benachbarten Inseln heimischen Homo erectus entwickelte. Die Anhänger dieser These gehen davon aus, dass eine lange Zeit der Isolation auf der kleinen Insel Flores zu einer klassischen Inselverzwergung geführt hat, wie man sie auch von vielen Tieren wie Waldelefanten und Mini-Rentieren kennt.
Einige Kritiker können sich damit jedoch nicht anfreunden: Sie halten es für ausgeschlossen, dass der kräftige, robuste Homo erectus mit seinem relativ großen Gehirn von etwa 1.000 Kubikzentimetern Volumen den winzigen Homo floresiensis hervorgebracht hat, dessen Gehirnvolumen auf unter 400 Kubikzentimeter geschätzt wird...
Um sich diesem Problem nun erneut zu nähern, haben Daisuke Kubo von der Universität Tokio und seine Kollegen zunächst den Schädel von LB1 neu vermessen, dem Skelett eines vermutlich weiblcihen Vertreters des Homo floresiensis. Dazu fertigten sie mit Hilfe extrem detailreicher CT-Aufnahmen dreidimensionale Modelle der Innenseite des Schädels an und korrigierten sie anschließend – etwa indem sie fehlende Stellen ergänzten, Deformierungen ausglichen und am Knochen haftendes Gestein abzogen, das bei der Ausgrabung nicht entfernt worden war. Heraus kam ein Gehirn, dessen Volumen 426 Kubikzentimeter betrug – und das somit deutlich größer war als die bisher geschätzten knapp 400 Kubikzentimeter.
Als nächstes berechnete das Team, wie groß ein Homo-erectus-Gehirn gewesen wäre, wenn dessen Körper nur die Größe des Hobbits gehabt hätte. Dazu ermittelten sie das Verhältnis von Gehirnvolumen zu Körpergröße bei Homo erectus-Funden und zum Vergleich auch bei 20 verschiedenen Homo-sapiens-Vertretern, sowie bei Homo habilis.
Das Ergebnis: Geht man von den Werten für eine Homo-erectus-Frau aus, war das Gehirn von H. floresiensis nur um 10 bis 29 Prozent kleiner, als es bei einer rein proportionalen Verkleinerung hätte sein dürfen. Diese Schrumpfung aber liegt noch durchaus innerhalb der Spannbreite, die für Inselverzwergungen typisch sind. Einen solchen Effekt kennt man auch von Tieren. So war beispielsweise das Gehirnvolumen des mittlerweile ausgestorbenen Madagassischen Zwergflusspferdes ebenfalls um etwa 30 Prozent geringer als es seine Körpergröße erwarten ließ. Und auch die früher auf Mallorca lebende Bergziege hatte ein um 50 Prozent kleineres Gehirn als es hätte sein sollen.
... link (0 Kommentare) ... comment
Mittwoch, 10. April 2013
Theistische Evolution
klauslange,14:02h
Auf kath.net gibt es einen philosophischen Gastkommentar zur theistischen Evolution.
Eine wesentliche Stütze für diese Art der Evolution, die sich äußerlich in Nichts von der darwinschen Evolution der Materialisten unterscheidet, ist Teilhard de Chardin.
Auch ich habe mich mit seinen Gedanken auseinandergesetzt. Mein Problem dabei ist, dass Teilhard aufgrund seiner paläontologischen Arbeiten den Druck verspürte, die Schöpfungstheologie der seiner Meinung nach naturwissenschaftlich bewiesenen Evolution des Menschen anzugleichen.
So war er dann auf der Suche nach Ansatzpunkten in der Kirchengeschichte, um diesen Entwicklungsgedanken vom Einzeller zum Menschen zu stützen. Er fand ein solch vermeintliches Einfallstor in der Theologie Thomas von Aquins. Doch der Schein trügt. Auch die thomistische Theologie will im Rahmen der Kirchenväter verstanden sein.
Man darf den Kirchlehrer des Mittelalters nicht gegen die Väter der frühen Kirche in einen Gegensatz bringen. Und für die Kirchenväter ist ganz klar, dass Adam keine kreatürlichen Vorfahren hatte. Im kath.net-Gastkommentar wird das auch ganz kurz in einem halben Nebensatz angedeutet.
Da es gegen die Väter aber keine Umdeutung von Inhalten geben darf, ist damit schon der theistisch evolutionäre Ansatz zum Scheitern verurteilt. Auch wenn die modernistische Theologie dies heute gerne ignorieren will...
Zur Klarstellung sei gesagt, dass auch Thomas von Aquin selbst eindeutige Aussagen gegen eine evolutionäre Abstammung Adams getan hat, so schreibt er, „...der Leib des ersten Menschen konnte nur unmittelbar von Gott selbst gebildet werden“ (Summa Theologica 7, Q. 91, A. 2.) und ist selbst damit auf einer Linie mit den Kirchenvätern.
Eine wesentliche Stütze für diese Art der Evolution, die sich äußerlich in Nichts von der darwinschen Evolution der Materialisten unterscheidet, ist Teilhard de Chardin.
Auch ich habe mich mit seinen Gedanken auseinandergesetzt. Mein Problem dabei ist, dass Teilhard aufgrund seiner paläontologischen Arbeiten den Druck verspürte, die Schöpfungstheologie der seiner Meinung nach naturwissenschaftlich bewiesenen Evolution des Menschen anzugleichen.
So war er dann auf der Suche nach Ansatzpunkten in der Kirchengeschichte, um diesen Entwicklungsgedanken vom Einzeller zum Menschen zu stützen. Er fand ein solch vermeintliches Einfallstor in der Theologie Thomas von Aquins. Doch der Schein trügt. Auch die thomistische Theologie will im Rahmen der Kirchenväter verstanden sein.
Man darf den Kirchlehrer des Mittelalters nicht gegen die Väter der frühen Kirche in einen Gegensatz bringen. Und für die Kirchenväter ist ganz klar, dass Adam keine kreatürlichen Vorfahren hatte. Im kath.net-Gastkommentar wird das auch ganz kurz in einem halben Nebensatz angedeutet.
Da es gegen die Väter aber keine Umdeutung von Inhalten geben darf, ist damit schon der theistisch evolutionäre Ansatz zum Scheitern verurteilt. Auch wenn die modernistische Theologie dies heute gerne ignorieren will...
Zur Klarstellung sei gesagt, dass auch Thomas von Aquin selbst eindeutige Aussagen gegen eine evolutionäre Abstammung Adams getan hat, so schreibt er, „...der Leib des ersten Menschen konnte nur unmittelbar von Gott selbst gebildet werden“ (Summa Theologica 7, Q. 91, A. 2.) und ist selbst damit auf einer Linie mit den Kirchenvätern.
... link (0 Kommentare) ... comment
Dienstag, 5. Februar 2013
Moderne Logistik in der Urzeit
klauslange,13:54h
Ein Paradigma des Evolutionismus auch für die gesellschaftliche Entwicklung der Menschheit lautet: Je weiter in der Geschichte zurück, desto primitiver die Fähigkeiten und Kenntnisse der Menschen.
Es gibt gute Gründe, dieses Dogma anzuzweifeln, auch wenn sich die Mainstream-Wissenschaft oft dagegen wehrt.
Nun aber wurde ein Fund gemacht, der aufzeigt, dass Menschen in Nordamerika schon vor mehr als 3000 Jahren zu Logisitkleistungen fähig waren, die den moderner Logistiker in nichts nachsteht, wie scinexx.de berichtet:
Die archäologische Fundstelle Poverty Point gilt als eine der frühesten und eindrucksvollsten Zeugnisse präkolumbianischer Baukunst. Das an einem Hang über dem Mississippi gelegene Areal umfasst auf einer Größe von rund 160 Hektar sechs große künstliche Hügel und sechs konzentrisch angeordnete Halbringe von mehr als einem Kilometer Länge. Bis zu eine Million Kubikmeter Erdreich wurden für diese gewaltige Anlage bewegt und aufgetürmt. Größtes Einzelbauwerk von Poverty Point ist der Mound A: Der T-förmige Hügel ragt mehr als zehn Meter in die Höhe und enthält knapp 240.000 Kubikmeter Erde - ein moderner Laster würde mehr als 30.000 Fuhren benötigen, um diese Menge Erde zu transportieren.
Und die Erde ist zudem keineswegs wahllos aufgeschüttet, wie archäologische Grabungen zeigen: Zunächst wurde der Bauplatz - ein Sumpfgebiet - durch Abbrennen von Vegetation befreit. Dann trugen die Erbauer eine dünne Schicht besonders feinen Lehm auf. Erst darüber häuften sie dann einzelne Hügel aus gröberer Erde auf, die nach und nach zu einer Masse zusammenwuchsen...
Einziges Transportmittel der Mound A-Erbauer waren vermutlich einfache Körbe oder Säcke, die die Menschen auf dem Kopf oder in den Armen herantrugen und dann auf den wachsenden Hügel entleerten. Bei einer durchschnittlichen Füllmenge von 25 Kilogramm Erde wären acht Millionen Korbladungen nötig gewesen, um den Hügel zu errichten. Unter anderem deshalb glaubte man bisher, dass solche archaischen Bauwerke der Jäger-und-Sammler-Zeit Jahrzehnte bis Jahrhunderte für ihre Fertigstellung brauchten. Denn man traute den normalerweise nur aus 25 bis 30 Menschen bestehenden Nomadensippen größere logistische Leistungen nicht zu.
Neue Ausgrabungen im Mound A zeichnen nun aber ein völlig anderes Bild: Kidder und seine Kollegen stellten bei der akribischen Analyse der Erdschichten fest, dass diese sehr schnell aufeinanderfolgend aufgeschichtet worden sein müssen. "Die Erde in diesem Hügel zeigt keinerlei Anzeichen für eine Erosion, beispielsweise durch einen während des Baus niedergegangenen Regenguss", erklärt Kidder. In dieser Region Louisianas regne es aber damals wie heute sehr häufig. "Selbst in einem sehr trockenen Jahr ist es äußerst unwahrscheinlich, dass es an diesem Ort länger als 90 Tage am Stück trocken geblieben ist", sagt Kidder. Dennoch sei der gesamte Hügel offenbar ohne Unterbrechung durch größere Regenperioden erbaut worden.
Die Archäologen schließen daraus, dass die vermeintlich wenig organisierten Nomaden den gesamten Mound A in nur 90 Tagen, vielleicht sogar in noch kürzerer Zeit errichteten. Das aber bedeutet, dass sich eine gewaltige Menschenmenge für den Bau zusammengefunden haben musste. Mindestens 3.000 Arbeiter, so schätzen die Archäologen, müssen nahezu Vollzeit daran gearbeitet haben. Da sie vermutlich von ihren Familien begleitet wurden, könnten während der Bauperiode bis zu 9.000 Menschen am Poverty Point gelebt und gearbeitet haben.
"Das widerspricht der lange etablierten Annahme, dass diese frühen Jäger-und-Sammler-Kulturen gar nicht die politische und soziale Organisation besaßen, um eine Arbeit durch so viele Menschen in so kurzer Zeit durchführen zu lassen", sagt Kidder. Die jetzt gewonnen Erkenntnisse seien der erste Beleg dafür, dass die frühen Nomadenvölker Nordamerikas weitaus weniger einfach gestrickt waren als bisher gedacht. "Wir müssen einsehen, dass das soziale Gefüge dieser Gesellschaften stärker und komplexer war, als wir es ihnen zugetraut haben", so der Forscher.
Es gibt gute Gründe, dieses Dogma anzuzweifeln, auch wenn sich die Mainstream-Wissenschaft oft dagegen wehrt.
Nun aber wurde ein Fund gemacht, der aufzeigt, dass Menschen in Nordamerika schon vor mehr als 3000 Jahren zu Logisitkleistungen fähig waren, die den moderner Logistiker in nichts nachsteht, wie scinexx.de berichtet:
Die archäologische Fundstelle Poverty Point gilt als eine der frühesten und eindrucksvollsten Zeugnisse präkolumbianischer Baukunst. Das an einem Hang über dem Mississippi gelegene Areal umfasst auf einer Größe von rund 160 Hektar sechs große künstliche Hügel und sechs konzentrisch angeordnete Halbringe von mehr als einem Kilometer Länge. Bis zu eine Million Kubikmeter Erdreich wurden für diese gewaltige Anlage bewegt und aufgetürmt. Größtes Einzelbauwerk von Poverty Point ist der Mound A: Der T-förmige Hügel ragt mehr als zehn Meter in die Höhe und enthält knapp 240.000 Kubikmeter Erde - ein moderner Laster würde mehr als 30.000 Fuhren benötigen, um diese Menge Erde zu transportieren.
Und die Erde ist zudem keineswegs wahllos aufgeschüttet, wie archäologische Grabungen zeigen: Zunächst wurde der Bauplatz - ein Sumpfgebiet - durch Abbrennen von Vegetation befreit. Dann trugen die Erbauer eine dünne Schicht besonders feinen Lehm auf. Erst darüber häuften sie dann einzelne Hügel aus gröberer Erde auf, die nach und nach zu einer Masse zusammenwuchsen...
Einziges Transportmittel der Mound A-Erbauer waren vermutlich einfache Körbe oder Säcke, die die Menschen auf dem Kopf oder in den Armen herantrugen und dann auf den wachsenden Hügel entleerten. Bei einer durchschnittlichen Füllmenge von 25 Kilogramm Erde wären acht Millionen Korbladungen nötig gewesen, um den Hügel zu errichten. Unter anderem deshalb glaubte man bisher, dass solche archaischen Bauwerke der Jäger-und-Sammler-Zeit Jahrzehnte bis Jahrhunderte für ihre Fertigstellung brauchten. Denn man traute den normalerweise nur aus 25 bis 30 Menschen bestehenden Nomadensippen größere logistische Leistungen nicht zu.
Neue Ausgrabungen im Mound A zeichnen nun aber ein völlig anderes Bild: Kidder und seine Kollegen stellten bei der akribischen Analyse der Erdschichten fest, dass diese sehr schnell aufeinanderfolgend aufgeschichtet worden sein müssen. "Die Erde in diesem Hügel zeigt keinerlei Anzeichen für eine Erosion, beispielsweise durch einen während des Baus niedergegangenen Regenguss", erklärt Kidder. In dieser Region Louisianas regne es aber damals wie heute sehr häufig. "Selbst in einem sehr trockenen Jahr ist es äußerst unwahrscheinlich, dass es an diesem Ort länger als 90 Tage am Stück trocken geblieben ist", sagt Kidder. Dennoch sei der gesamte Hügel offenbar ohne Unterbrechung durch größere Regenperioden erbaut worden.
Die Archäologen schließen daraus, dass die vermeintlich wenig organisierten Nomaden den gesamten Mound A in nur 90 Tagen, vielleicht sogar in noch kürzerer Zeit errichteten. Das aber bedeutet, dass sich eine gewaltige Menschenmenge für den Bau zusammengefunden haben musste. Mindestens 3.000 Arbeiter, so schätzen die Archäologen, müssen nahezu Vollzeit daran gearbeitet haben. Da sie vermutlich von ihren Familien begleitet wurden, könnten während der Bauperiode bis zu 9.000 Menschen am Poverty Point gelebt und gearbeitet haben.
"Das widerspricht der lange etablierten Annahme, dass diese frühen Jäger-und-Sammler-Kulturen gar nicht die politische und soziale Organisation besaßen, um eine Arbeit durch so viele Menschen in so kurzer Zeit durchführen zu lassen", sagt Kidder. Die jetzt gewonnen Erkenntnisse seien der erste Beleg dafür, dass die frühen Nomadenvölker Nordamerikas weitaus weniger einfach gestrickt waren als bisher gedacht. "Wir müssen einsehen, dass das soziale Gefüge dieser Gesellschaften stärker und komplexer war, als wir es ihnen zugetraut haben", so der Forscher.
... link (0 Kommentare) ... comment
Freitag, 25. Januar 2013
Gängige Theorie zur Evolution des Vogelflugs widerlegt!
klauslange,10:54h
Eine neuer Fund in China widerlegt alle gängigen Theorien zur Evolution des Vogelflugs, wie science daily meldet:
Co-authored by Dr Gareth Dyke, Senior Lecturer in Vertebrate Palaeontology at the University of Southampton, the paper describes a new feathered dinosaur about 30 cm in length which pre-dates bird-like dinosaurs that birds were long thought to have evolved from.
Over many years, it has become accepted among palaeontologists that birds evolved from a group of dinosaurs called theropods from the Early Cretaceous period of Earth's history, around 120-130 million years ago. Recent discoveries of feathered dinosaurs from the older Middle-Late Jurassic period have reinforced this theory.
The new 'bird-dinosaur' Eosinopteryx described in Nature Communications this week provides additional evidence to this effect.
"This discovery sheds further doubt on the theory that the famous fossil Archaeopteryx -- or "first bird" as it is sometimes referred to -- was pivotal in the evolution of modern birds," says Dr Dyke, who is based at the National Oceanography Centre, Southampton.
"Our findings suggest that the origin of flight was much more complex than previously thought."
Dies belegt einmal mehr, dass als sicher geltende Evolutionsszenarien eben keine Theorien sind, die eine solche Klassifizierung verdienen, sondern reines 'story telling'. Man kann sich zu den Fossilfunden immer irgend welche Geschichtchen ausdenken, die aber besser in ein Märchenbuch gehören, als in wissenschaftlichen Lehrbüchern.
Wenn die beteiligten Forscher, die den neuen Fund vorstellen, davon sprechen, dass die "Evolution des Vogelflugs" weit komplexer ist, als zunächst gedacht, dann kann man es auch so ausdrücken: Man hat es sich zu einfach gemacht!
Und das, so meine ich, gilt für das gesamte Evolutionsparadigma neodarwinistischer Prägung: Man macht es sich zu einfach!
Co-authored by Dr Gareth Dyke, Senior Lecturer in Vertebrate Palaeontology at the University of Southampton, the paper describes a new feathered dinosaur about 30 cm in length which pre-dates bird-like dinosaurs that birds were long thought to have evolved from.
Over many years, it has become accepted among palaeontologists that birds evolved from a group of dinosaurs called theropods from the Early Cretaceous period of Earth's history, around 120-130 million years ago. Recent discoveries of feathered dinosaurs from the older Middle-Late Jurassic period have reinforced this theory.
The new 'bird-dinosaur' Eosinopteryx described in Nature Communications this week provides additional evidence to this effect.
"This discovery sheds further doubt on the theory that the famous fossil Archaeopteryx -- or "first bird" as it is sometimes referred to -- was pivotal in the evolution of modern birds," says Dr Dyke, who is based at the National Oceanography Centre, Southampton.
"Our findings suggest that the origin of flight was much more complex than previously thought."
Dies belegt einmal mehr, dass als sicher geltende Evolutionsszenarien eben keine Theorien sind, die eine solche Klassifizierung verdienen, sondern reines 'story telling'. Man kann sich zu den Fossilfunden immer irgend welche Geschichtchen ausdenken, die aber besser in ein Märchenbuch gehören, als in wissenschaftlichen Lehrbüchern.
Wenn die beteiligten Forscher, die den neuen Fund vorstellen, davon sprechen, dass die "Evolution des Vogelflugs" weit komplexer ist, als zunächst gedacht, dann kann man es auch so ausdrücken: Man hat es sich zu einfach gemacht!
Und das, so meine ich, gilt für das gesamte Evolutionsparadigma neodarwinistischer Prägung: Man macht es sich zu einfach!
... link (0 Kommentare) ... comment
Freitag, 11. Januar 2013
Entdeckung widerspricht dem kosmologischen Prinzip und stützt Urwort-Modell
klauslange,12:04h
Wenn es darum geht lokale Verhältnisse auf andere Regionen des Universums zu übertragen, dann wird u.a. mit dem kosmologischen Prinzip argumentiert.
Neueste Beobachtungen des Alls zeigen aber eine Struktur, die eindeutig dem kosmologischen Prinzip widerspricht, wie scinexx.de berichtet:
Astronomen haben eine Quasargruppe entdeckt, die größer ist als jede andere bekannte Struktur im Universum. Die Ansammlung von aktiven Galaxienkernen misst an ihrer längsten Stelle 1.200 Megaparsec- das entspricht der 1.600fachen Entfernung von der Milchstraße zu unserer Nachbargalaxie Andromeda. Ein Objekt dieser Größe aber dürfte es eigentlich im Kosmos gar nicht geben, denn dies widerspricht dem sogenannten kosmologischen Prinzip.
Quasare gehören zu den hellsten Objekten im Universum. Diese Kerne weit entfernter Galaxien aus dem frühen Kosmos strahlen eine gewaltige Energiemenge ab und sind daher über große Entfernungen auszumachen. Ähnlich wie auch andere Objekte im Weltall kommen auch diese kosmischen Leuchtfeuer oft "geklumpt" vor - sie bilden sogenannte Large Quasar Groups (LQG). Diese Gruppen sind rund zehn Mal so groß wie typische Galaxienhaufen: Statt gerade einmal zwei bis drei Megaparsec erreichen sie 200 und mehr. Typischerweise umfassen sie zwischen fünf und 40 Quasare, wie Clowes und seine Kollegen erklären.
Viel größer aber, so glaubte man bisher, können auch diese Giganten des frühen Universums nicht werden. Denn wären sie größer als etwa 370 Megaparsec, würden sie dem kosmologischen Prinzip widersprechen - sie würden Materieklumpen erzeugen, die selbst beim Betrachten eines großen Ausschnitts des Universums nicht mehr mit dem Rest zu einem homogenen "Teppich" verschmelzen würden.
"Die Entdeckung einer deutlich größeren Struktur deutet nun darauf hin, dass das Universum in diesen Größenordnungen doch nicht homogen ist", konstatieren Clowes und seine Kollegen. Die von ihnen Riesen-LQG getaufte Quasargruppe nimmt immerhin im Durchschnitt 500 Megaparsec des Weltraums ein und ist noch deutlich länger. Und in Bezug auf die in ihr enthaltenen Galaxienkerne - 73 - übertrifft sie alle bisher bekannten Gruppen ebenfalls bei weitem, wie die Forscher berichten.
Entdeckt hatten die Astronomen die Quasargruppe bei der Auswertung von Daten einer großen Himmelsdurchmusterung, des Sloane Digital Sky Survey (SDSS). Für diesen tastet ein 2,5 Meter-Teleskop mit elektronischen Detektoren systematisch ein Gebiet am nördlichen Pol der Milchstraße ab. Ausgerüstet mit Sensoren für verschiedenen Helligkeiten und fünf Wellenlängen kann es so weit entfernte Galaxien und Quasare, aber auch nahe Braune Zwerge oder Asteroiden erfassen. Clowes und sein Team wollen nun weiter in den SDSS-Daten suchen und hoffen, möglicherweise noch weitere solcher extrem großer Objekte zu finden. "Wir werden auf jeden Fall diese faszinierenden Phänomene weiter untersuchen", sagt Clowes.
Auf so eine Meldung habe ich gewartet, denn sie bereitet dem kosmologischen Prinzip und insbesondere dem Urknall - herkömmlicher Lesart - Probleme, nicht aber dem Entstehungsmodell nach der Urwort-Theorie, in der solch große Strukturen selbstverständlich sind!
Neueste Beobachtungen des Alls zeigen aber eine Struktur, die eindeutig dem kosmologischen Prinzip widerspricht, wie scinexx.de berichtet:
Astronomen haben eine Quasargruppe entdeckt, die größer ist als jede andere bekannte Struktur im Universum. Die Ansammlung von aktiven Galaxienkernen misst an ihrer längsten Stelle 1.200 Megaparsec- das entspricht der 1.600fachen Entfernung von der Milchstraße zu unserer Nachbargalaxie Andromeda. Ein Objekt dieser Größe aber dürfte es eigentlich im Kosmos gar nicht geben, denn dies widerspricht dem sogenannten kosmologischen Prinzip.
Quasare gehören zu den hellsten Objekten im Universum. Diese Kerne weit entfernter Galaxien aus dem frühen Kosmos strahlen eine gewaltige Energiemenge ab und sind daher über große Entfernungen auszumachen. Ähnlich wie auch andere Objekte im Weltall kommen auch diese kosmischen Leuchtfeuer oft "geklumpt" vor - sie bilden sogenannte Large Quasar Groups (LQG). Diese Gruppen sind rund zehn Mal so groß wie typische Galaxienhaufen: Statt gerade einmal zwei bis drei Megaparsec erreichen sie 200 und mehr. Typischerweise umfassen sie zwischen fünf und 40 Quasare, wie Clowes und seine Kollegen erklären.
Viel größer aber, so glaubte man bisher, können auch diese Giganten des frühen Universums nicht werden. Denn wären sie größer als etwa 370 Megaparsec, würden sie dem kosmologischen Prinzip widersprechen - sie würden Materieklumpen erzeugen, die selbst beim Betrachten eines großen Ausschnitts des Universums nicht mehr mit dem Rest zu einem homogenen "Teppich" verschmelzen würden.
"Die Entdeckung einer deutlich größeren Struktur deutet nun darauf hin, dass das Universum in diesen Größenordnungen doch nicht homogen ist", konstatieren Clowes und seine Kollegen. Die von ihnen Riesen-LQG getaufte Quasargruppe nimmt immerhin im Durchschnitt 500 Megaparsec des Weltraums ein und ist noch deutlich länger. Und in Bezug auf die in ihr enthaltenen Galaxienkerne - 73 - übertrifft sie alle bisher bekannten Gruppen ebenfalls bei weitem, wie die Forscher berichten.
Entdeckt hatten die Astronomen die Quasargruppe bei der Auswertung von Daten einer großen Himmelsdurchmusterung, des Sloane Digital Sky Survey (SDSS). Für diesen tastet ein 2,5 Meter-Teleskop mit elektronischen Detektoren systematisch ein Gebiet am nördlichen Pol der Milchstraße ab. Ausgerüstet mit Sensoren für verschiedenen Helligkeiten und fünf Wellenlängen kann es so weit entfernte Galaxien und Quasare, aber auch nahe Braune Zwerge oder Asteroiden erfassen. Clowes und sein Team wollen nun weiter in den SDSS-Daten suchen und hoffen, möglicherweise noch weitere solcher extrem großer Objekte zu finden. "Wir werden auf jeden Fall diese faszinierenden Phänomene weiter untersuchen", sagt Clowes.
Auf so eine Meldung habe ich gewartet, denn sie bereitet dem kosmologischen Prinzip und insbesondere dem Urknall - herkömmlicher Lesart - Probleme, nicht aber dem Entstehungsmodell nach der Urwort-Theorie, in der solch große Strukturen selbstverständlich sind!
... link (0 Kommentare) ... comment
Mittwoch, 2. Januar 2013
Sonnensystem ohne vorhergende Supernova
klauslange,13:14h
Das evolutionistische Paradigma hat ja mittlerweile in allen Gebieten Einzug gehalten, so auch in der Astrophysik: So soll unser Sonnensystem aus den Überresten einer Supernova entstanden sein. Dies wurde bislang als Fakt publik gemacht. Und man hatte dafür auch Gründe, die man in Zerfallsreihen radioaktiver Isotope meinte gefunden zu haben.
Doch den bisherigen Befunden wird nun klar widersprochen, das Sonnensystem entstand ohne das vorherige Feuerwerk - um den frühen Jahresanfang als Bild zu gebrauchen -, was eine senstionelle Erkenntnis wäre. Würde man diesen Widerspruch auf das gesamte Universum übertragen, dann wäre die Tragweite in etwa so, als ob man nun handfeste Belege aufzeigte, dass der Urknall niemals stattgefunden hätte.
Die neuen Ergebnisse haben bezpgen auf unser Sonnensystem und überhaupt der Entwicklungsmodelle aller Sternensysteme enormen Einfluss.
Welt der Physik berichtet, wenn auch noch sehr vorsichtig, wozu es keinen sachlichen Grund gibt:
„Wenn es einen hohen Anteil an Eisen-60 gab, so wäre das ein Beweis für eine Supernova“, erläutert Nicolas Dauphas von der University of Chicago. Denn dieses mit einer Halbwertszeit von 2,6 Millionen Jahren zerfallende Isotop kann nur durch die Explosion eines nahen Sterns in die Gaswolke gelangt sein, aus der das Sonnensystem sich gebildet hat. Mehrere Untersuchungen haben in der Vergangenheit Hinweise auf einen solchen erhöhten Anteil an Zerfallsprodukten von Eisen-60 in Meteoriten geliefert. Doch die früheren Studien sind nach Ansicht von Dauphas und seinem Kollegen Haolan Tang durch Verunreinigungen in dem untersuchten Material mit großen Unsicherheiten behaftet: „Die Ergebnisse klaffen um mehr als das Hundertfache auseinander.“
Die beiden Forscher haben deshalb eine große Zahl unterschiedlicher meteoritischer Materialien mit verbesserten Methoden untersucht. Sie kommen dabei auf einen deutlich niedrigeren Wert für den ursprünglichen Anteil an Eisen-60 als die früheren Analysen. „Dieser neue, niedrige Wert ist in Einklang mit der Aufnahme des Isotops aus dem interstellaren Medium“, so Tang und Dauphas. Es stamme also nicht von einer einzigen, nahen Supernova, sondern von einer Vielzahl explodierter Sterne, die das Gas zwischen den Sternen im Verlauf von Jahrmilliarden mit ihren Elementen angereichert haben. Für dieses Szenario spricht auch der Befund, dass das Eisen-60 gleichmäßig im jungen Sonnensystem verteilt war. Denn Tang und Dauphas fanden keine Differenzen zwischen Meteoriten unterschiedlicher Herkunft.
Als weiteres Indiz für das Supernovaszenario wurde bislang ein hoher Anteil an Zerfallsprodukten des Isotops Aluminium-26 in Meteoriten angesehen. Tang und Dauphas sehen aber auch hier einen anderen Prozess am Werk: Dieses Isotop kann, da es erheblich leichter als Eisen-60 ist, bereits durch starke Sternwinde großer, massereicher Sterne ins Weltall und damit auch in die Urwolke des Sonnensystems transportiert werden. „Es besteht also keine Notwendigkeit, eine nahe Sternexplosion anzunehmen“, so Dauphas.
Doch den bisherigen Befunden wird nun klar widersprochen, das Sonnensystem entstand ohne das vorherige Feuerwerk - um den frühen Jahresanfang als Bild zu gebrauchen -, was eine senstionelle Erkenntnis wäre. Würde man diesen Widerspruch auf das gesamte Universum übertragen, dann wäre die Tragweite in etwa so, als ob man nun handfeste Belege aufzeigte, dass der Urknall niemals stattgefunden hätte.
Die neuen Ergebnisse haben bezpgen auf unser Sonnensystem und überhaupt der Entwicklungsmodelle aller Sternensysteme enormen Einfluss.
Welt der Physik berichtet, wenn auch noch sehr vorsichtig, wozu es keinen sachlichen Grund gibt:
„Wenn es einen hohen Anteil an Eisen-60 gab, so wäre das ein Beweis für eine Supernova“, erläutert Nicolas Dauphas von der University of Chicago. Denn dieses mit einer Halbwertszeit von 2,6 Millionen Jahren zerfallende Isotop kann nur durch die Explosion eines nahen Sterns in die Gaswolke gelangt sein, aus der das Sonnensystem sich gebildet hat. Mehrere Untersuchungen haben in der Vergangenheit Hinweise auf einen solchen erhöhten Anteil an Zerfallsprodukten von Eisen-60 in Meteoriten geliefert. Doch die früheren Studien sind nach Ansicht von Dauphas und seinem Kollegen Haolan Tang durch Verunreinigungen in dem untersuchten Material mit großen Unsicherheiten behaftet: „Die Ergebnisse klaffen um mehr als das Hundertfache auseinander.“
Die beiden Forscher haben deshalb eine große Zahl unterschiedlicher meteoritischer Materialien mit verbesserten Methoden untersucht. Sie kommen dabei auf einen deutlich niedrigeren Wert für den ursprünglichen Anteil an Eisen-60 als die früheren Analysen. „Dieser neue, niedrige Wert ist in Einklang mit der Aufnahme des Isotops aus dem interstellaren Medium“, so Tang und Dauphas. Es stamme also nicht von einer einzigen, nahen Supernova, sondern von einer Vielzahl explodierter Sterne, die das Gas zwischen den Sternen im Verlauf von Jahrmilliarden mit ihren Elementen angereichert haben. Für dieses Szenario spricht auch der Befund, dass das Eisen-60 gleichmäßig im jungen Sonnensystem verteilt war. Denn Tang und Dauphas fanden keine Differenzen zwischen Meteoriten unterschiedlicher Herkunft.
Als weiteres Indiz für das Supernovaszenario wurde bislang ein hoher Anteil an Zerfallsprodukten des Isotops Aluminium-26 in Meteoriten angesehen. Tang und Dauphas sehen aber auch hier einen anderen Prozess am Werk: Dieses Isotop kann, da es erheblich leichter als Eisen-60 ist, bereits durch starke Sternwinde großer, massereicher Sterne ins Weltall und damit auch in die Urwolke des Sonnensystems transportiert werden. „Es besteht also keine Notwendigkeit, eine nahe Sternexplosion anzunehmen“, so Dauphas.
... link (0 Kommentare) ... comment
Samstag, 8. Dezember 2012
Metamorphose
klauslange,21:12h
Heute habe ich einen sehr interessanten Film über die Metamorphose der Schmetterlinge gesehen und es zeigt sich, dass mit ungerichteten, zufälligen Mutationen, die kleinen Selektionsschritten unterworfen sind, eine Entstehung der Metamorphose nicht möglich ist.
Natürlich habe ich darüber gegooglet, was denn die Biologen des Mainstreams dazu sagen. Aber mehr als 'Story telling', die krampfhaft versucht das Scheitern des Evolutionsparadigmas zu verschleiern, kommt nicht zustande.
Metamorphose kann ja nur funktionieren, wenn der Zielorganismus als solcher bekannt ist und eine evolutionäre Entwicklung dahin zielgerichtet ist. Das widerspricht schon der Definition der ungerichteten Evolution.
Die konkreten Hürden, die eine darwinsche Evolution nehmen müsste, werden dann ausgeblendet. Statt detaillierten Analysen, findet man daher nur Denkmöglichkeiten. Frei nach dem Motto: Es muss ja einen evolutiven Weg geben, denn sonst würde es die Metamorphose nicht geben. Damit überbrückt man dann die evolutiven Sackgassen.
Bleibt also nur die Aussage des Films: Ein intelligenter Designer ist unumgänglich!
Ein wichtiger Film!

Natürlich habe ich darüber gegooglet, was denn die Biologen des Mainstreams dazu sagen. Aber mehr als 'Story telling', die krampfhaft versucht das Scheitern des Evolutionsparadigmas zu verschleiern, kommt nicht zustande.
Metamorphose kann ja nur funktionieren, wenn der Zielorganismus als solcher bekannt ist und eine evolutionäre Entwicklung dahin zielgerichtet ist. Das widerspricht schon der Definition der ungerichteten Evolution.
Die konkreten Hürden, die eine darwinsche Evolution nehmen müsste, werden dann ausgeblendet. Statt detaillierten Analysen, findet man daher nur Denkmöglichkeiten. Frei nach dem Motto: Es muss ja einen evolutiven Weg geben, denn sonst würde es die Metamorphose nicht geben. Damit überbrückt man dann die evolutiven Sackgassen.
Bleibt also nur die Aussage des Films: Ein intelligenter Designer ist unumgänglich!
Ein wichtiger Film!

... link (0 Kommentare) ... comment
Freitag, 30. November 2012
Hildegard von Bingen über die Schöpfung
klauslange,17:35h
"Alles was Gott gewirkt hat, hatte Er vor Beginn der Zeit in Seiner Gegenwart.
In der reinen und heiligen Gottheit leuchteten alle sichtbaren und unsichtbaren Dinge ohne zeitlichen Augenblick und ohne Zeitablauf vor aller Ewigkeit, so wie sich Bäume und andere kreatürliche Dinge in naheliegenden Gewässer widerspiegeln, ohne doch körperlich in ihnen zu sein, wenngleich ihre Umrisse in diesem Spiegel erscheinen.
Als Gott sprach: "Es werde" hüllten sich die Dinge sofort in ihre Gestalt,
so wie Sein Vorherwissen sie vor der Zeit körperlos geschaut hatte."*
*Heilige Kirchenlehrerin Hildegard von Bingen, Welt und Mensch
In der reinen und heiligen Gottheit leuchteten alle sichtbaren und unsichtbaren Dinge ohne zeitlichen Augenblick und ohne Zeitablauf vor aller Ewigkeit, so wie sich Bäume und andere kreatürliche Dinge in naheliegenden Gewässer widerspiegeln, ohne doch körperlich in ihnen zu sein, wenngleich ihre Umrisse in diesem Spiegel erscheinen.
Als Gott sprach: "Es werde" hüllten sich die Dinge sofort in ihre Gestalt,
so wie Sein Vorherwissen sie vor der Zeit körperlos geschaut hatte."*
*Heilige Kirchenlehrerin Hildegard von Bingen, Welt und Mensch
... link (0 Kommentare) ... comment
Montag, 19. November 2012
Steinspeerspitzen schon vor 500.000 Jahren!
klauslange,13:33h
Schon vor 500.000 Jahren gab es Menschen, die Steinspeerspitzen herstellen konnten. Das stellt bisherige Ansichten über die Primitivität des Frühmenschen erheblich infrage.
Einen Eindruck vermittelt ein Bericht von scinexx.de:
Unsere Vorfahren nutzen schon viel früher steinerne Speerspitzen zur Jagd als gedacht. Das belegen 500.000 Jahre alte Steinspitzen aus Südafrika, die ein internationales Forscherteam jetzt näher untersucht hat. Aus den Gebrauchsspuren und der Form der steinernen Dreiecksklingen gehe hervor, dass sie einst an Speer- oder Pfeilschäften befestigt waren. Sie seien damit rund 200.000 Jahre älter als die frühesten bisher bekannten Beispiele für solche zusammengesetzten Jagdwaffen, berichten die Forscher im Fachmagazin "Science".
Einen Eindruck vermittelt ein Bericht von scinexx.de:
Unsere Vorfahren nutzen schon viel früher steinerne Speerspitzen zur Jagd als gedacht. Das belegen 500.000 Jahre alte Steinspitzen aus Südafrika, die ein internationales Forscherteam jetzt näher untersucht hat. Aus den Gebrauchsspuren und der Form der steinernen Dreiecksklingen gehe hervor, dass sie einst an Speer- oder Pfeilschäften befestigt waren. Sie seien damit rund 200.000 Jahre älter als die frühesten bisher bekannten Beispiele für solche zusammengesetzten Jagdwaffen, berichten die Forscher im Fachmagazin "Science".
... link (0 Kommentare) ... comment
... nächste Seite